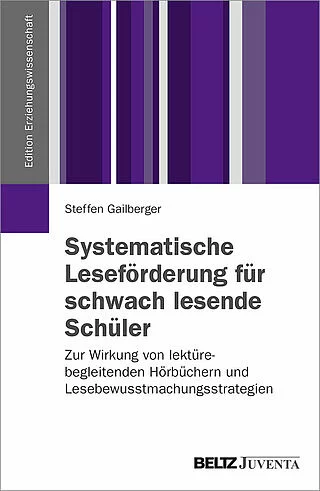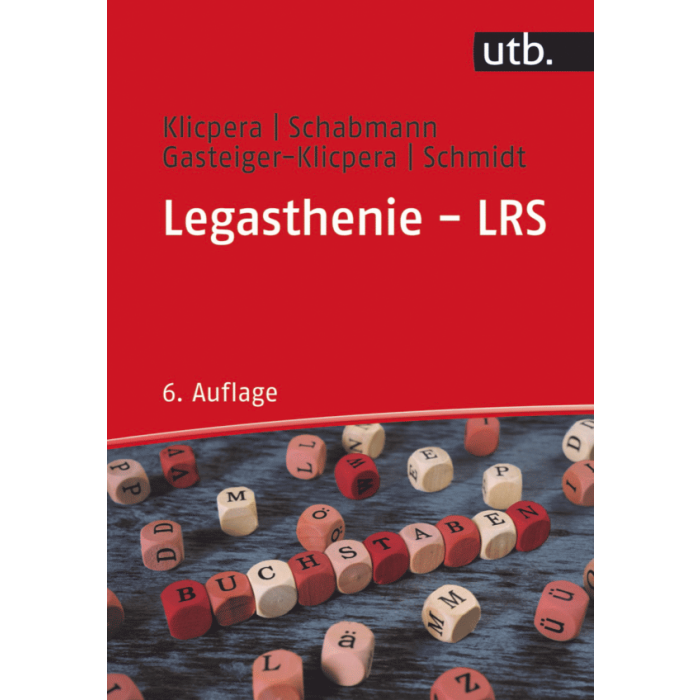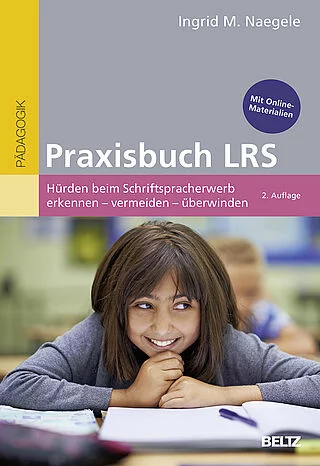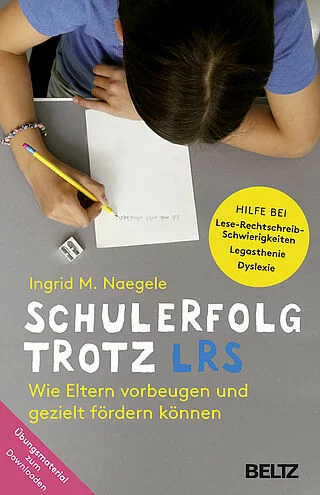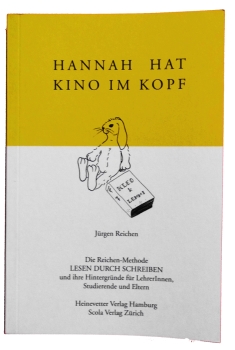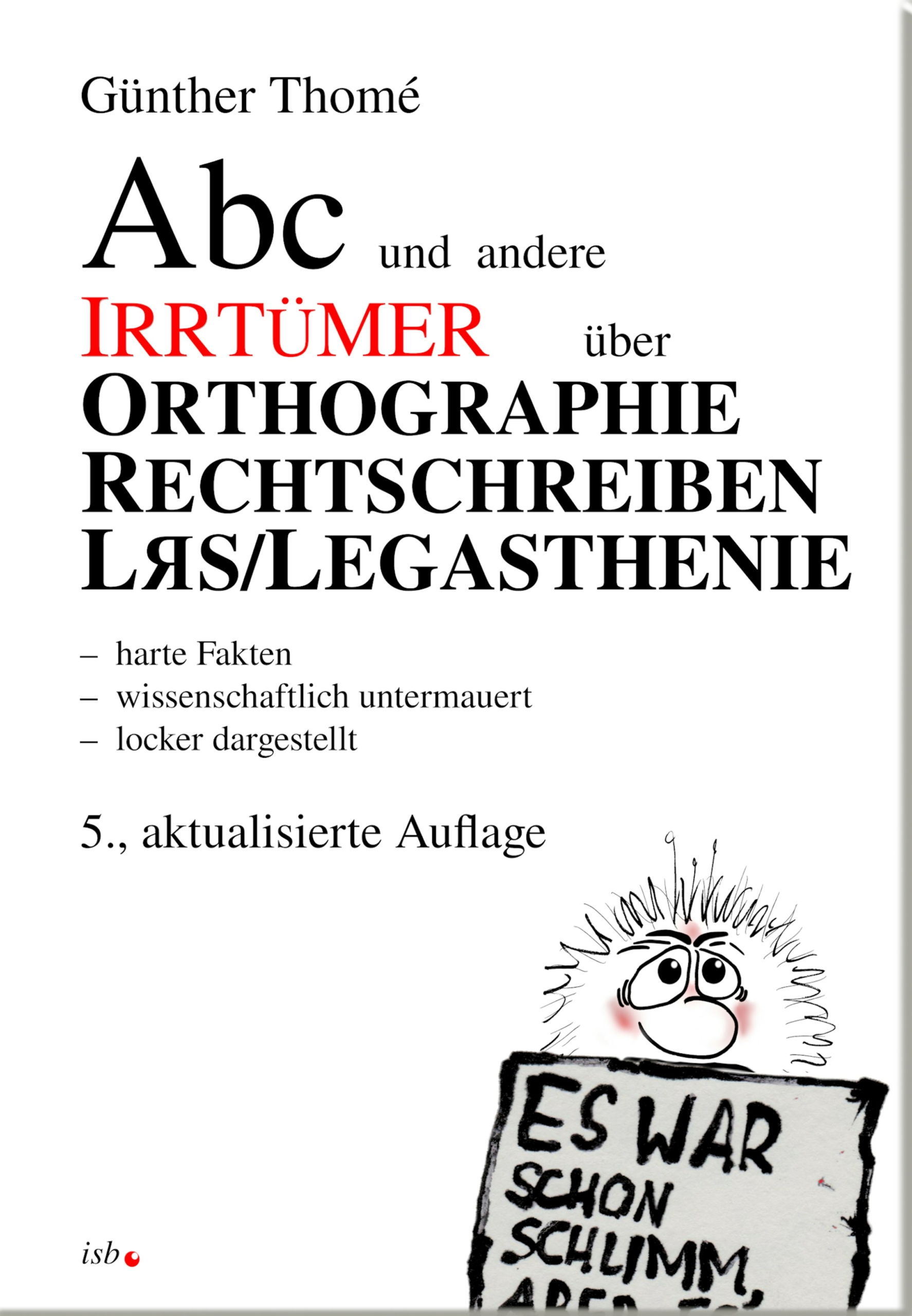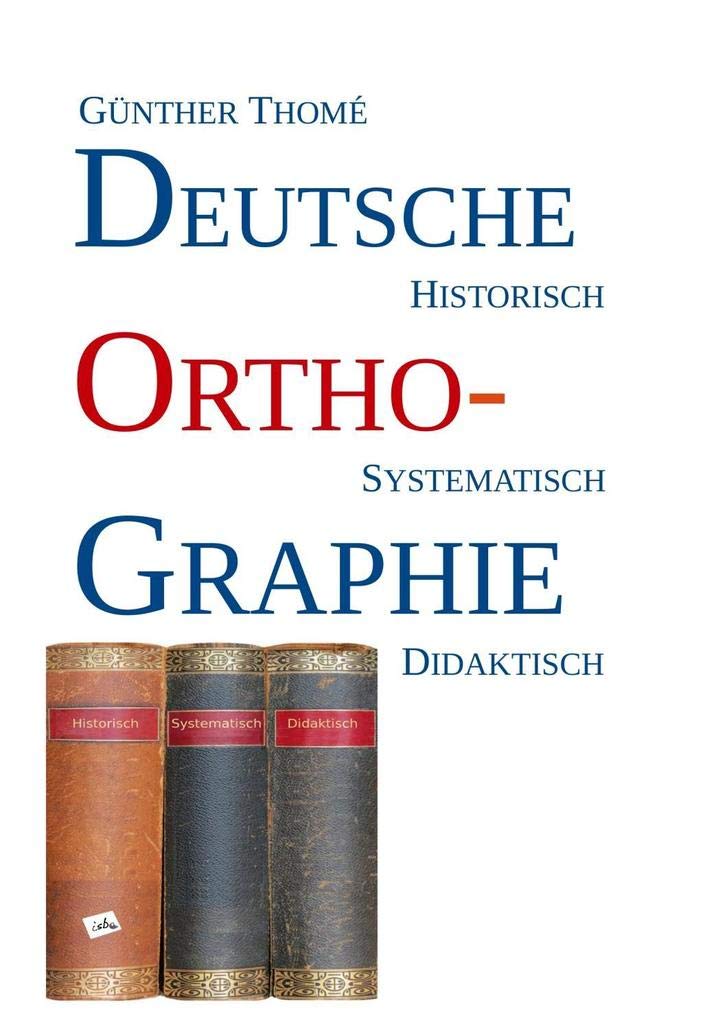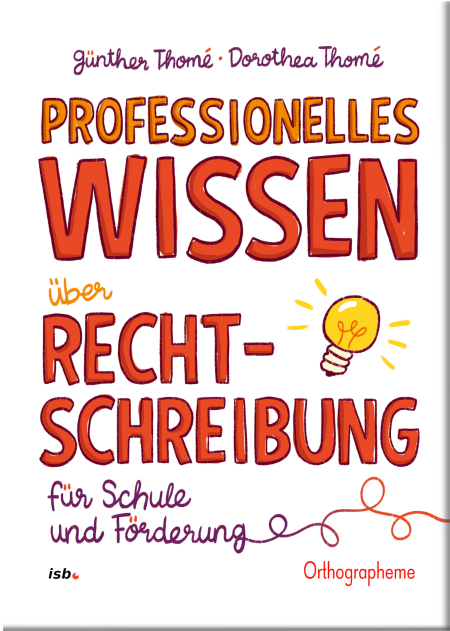Zu meinen Lerntechniken gehört es seit meinem Studium, dass ich ein Fachbuch mit Anmerkungen versehe und zum Schluss die Stellen mit den Notizen noch einmal anschaue. Jetzt habe ich zusätzlich eine kleine Rezension geschrieben. Das ♥ steht bei meinen Lieblingsbüchern, die ich allen Lesepaten empfehle.
Apenburg, Heddi - Legasthenie - Was Eltern wissen sollten

Heddi Apenburg – Legasthenie – Was Eltern wissen sollten – Kindle Edition
Heddi Apenburg – Legasthenie – Was Eltern wissen sollten – E-Book, Kindle Amazon – 2014
Ich habe schon einige Bücher mit einer ähnlichen Themenstellung gelesen. Dieses Buch hat mir aber besonders gut gefallen, weil es ehrlich ist, kein Fachchinesisch enthält und weil es einen guten Überblick über das Thema anhand von tatsächlich häufig gestellten Fragen bietet.
Es war mein erstes E-Book, und ich bin, nach anfänglicher Skepsis, von den Möglichkeiten begeistert, die einem gerade als Fachbuchleser, der sich Notizen macht, zur Verfügung stehen. Ich habe bei vielen Textpassagen einfach nur geschrieben: „Jawohl, so ist es!“
Ich stimme auch zu, dass man den Kindern erst einmal klar machen muss, dass sie ein Handicap haben. Es geht nicht darum, wie C. Schmitz in seiner Kritik zu diesem Buch schreibt, LRS zu akzeptieren, sondern ein Handicap oder fehlendes Talent zu verstehen, das einen zu mehr Anstrengung zwingt, als wenn man das Handicap nicht hätte. Dieses Bewusstsein muss man den Kindern vermitteln. Beispiele, wo man selbst Probleme hatte oder noch hat, überzeugen die Kinder in aller Regel.
Wenn Frau Apenburg schreibt, dass die Aufgabe der Eltern darin bestehe, dem Kind Mut zu machen, dann kann ich auch da nur voll zustimmen. Eigentlich sollte die Schule schon bei der Einschulung des Kindes die Eltern auf diesen Punkt aufmerksam machen. Dazu gehört auch, den Eltern zu sagen, dass sie bei den ersten Anzeichen von wiederholtem ungenauen Lesen Hilfestellung geben sollten. Langsam und genau zu lesen, darauf kommt es an. Am Anfang des Leselernprozesses schnell und falsch zu lesen, das führt zu LRS. Früher hat man in solchen Fällen mit dem Leselineal geübt und immer nur ein Wort oder einzelne Buchstaben freigegeben. Ich mache das mit dem Computer mit zeichenweiser oder wortweiser Darbietung des Textes.
Barnieske, Andreas - In Lautlesetandems die Leseflüssigkeit trainieren ♥

Andreas Barnieske – In Lautlesetandems die Leseflüssigkeit trainieren – Auer – ISBN 978-3-403-08173-9
Ein schönes Buch, praxisorientiert, etwas Theorie, nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist auch für Lesepaten interessant.
Das eine oder andere Beispiel kommt mir zwar etwas weltfremd vor, was aber insgesamt nicht stört. Ein Beispiel ist die Schülerin, die die Lehrkraft bittet, sich einen Teil einer Arbeitsanweisung zu merken, damit sie sich mit dem zweiten Teil beschäftigen kann.
Aber ansonsten stimmen die Empfehlungen mit meinen Erfahrungen überein. Zum Beispiel, dass kürzere Texte mehrmals hintereinander erlesen werden sollen. Ja, die Wiederholungen bringen es! Und bei der folgenden Passage kann ich auch nur Bravo rufen: „Jeder Text sollte innerhalb der Trainingszeit mindestens drei- bis viermal gelesen werden können.“ Das Buch enthält Hinweise, wie man Tandemlesen in der Klasse installieren kann. Doch die Durchführungshinweise sind auch – wie schon gesagt – für Lesepaten interessant.
Auch ein Lesetest ist vorhanden. Die Schüler sollen schnell entscheiden, ob ein Satz stimmt oder nicht.
Sehr hilfreich finde ich die kurzen Lesetexte. Ich werde das Heft zu den Trainings mit meinen Schülern mitnehmen und immer mal wieder eine dieser kurzen Geschichten mit meinen Schülern lesen.
Wegen der Absatznummerierungen bei den kurzen Lesetexten, die bei der coronabedingten „Abstandskommunikation“ aktuell war, könnte man mit zwei Exemplaren besonders gut mit einem Schüler üben.
Born und Oehler - Lernen mit Grundschulkindern ♥
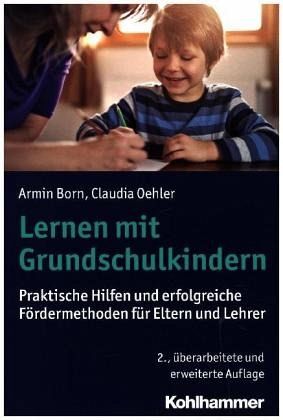
Born und Oehler – Lernen mit Grundschulkindern
Armin Born, Claudia Oehler – Lernen mit Grundschulkindern – Praktische Hilfen und erfolgreiche Fördermethoden für Eltern und Lehrer – Kohlhammer, 2017, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage
Auf dieses Buch von Armin Born und Claudia Oehler bin ich durch eine Grundschulrektorin aufmerksam geworden. Nach kurzer Einsichtnahme wollte ich mir das Buch sofort bestellen, musste aber auf die Neuauflage warten. Die ist mir jetzt einen Blogbeitrag wert, weil die Autoren die Probleme punktgenau benennen.
Das Buch bringt gut erklärte Theorie und praktische Handlungsanleitungen, die leicht umgesetzt werden können. Es sollte nicht nur von der anvisierten Zielgruppe, nämlich den Eltern sowie den Lehrern, sondern auch von denjenigen gelesen werden, die für die Gestaltung und Ausstattung des Systems Schule und für die Lehrpläne verantwortlich sind. Die Bedeutung der ersten beiden Grundschulklassen wird von den Autoren überzeugend dargestellt. Und da könnte in der Praxis mehr geschehen.
Die Autoren machen deutlich, dass Training oft im luftleeren Raum erfolgt, weil die Basisfertigkeiten nicht ausreichend automatisiert ablaufen. Das ist genau das Problem, das ich bei allen meinen Schülern beobachten kann. Die grundlegenden Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen belasten die Schüler enorm: zeitlich, physisch und manchmal auch psychisch. Ein Zugewinn an Fertigkeiten ist nahezu unmöglich. (Siehe meinen Blogbeitrag von 2013: Auf Sand gebaut.)
Die Autoren schreiben, dass sie sich bewusst seien, gerade für Lehrerinnen und Lehrer Gewohntes und als sicher Angenommenes infrage zu stellen. Mir dagegen, als Quereinsteiger, sprechen sie aus der Seele. Ein höherer Beamter in der Schulbürokratie hat mir einmal in einer Diskussion gesagt, dass ich den Vorteil hätte, nicht von der Reformpädagogik verdorben worden zu sein.
Zu Beginn des Buches befindet sich eine lesenswerte Beschreibung des Istzustandes aus den Blickwinkeln der Eltern, der Lehrer, der Wirtschaft und der psychologisch-medizinischen Fachwelt. Die Autoren scheuen sich auch nicht, klar zu sagen, dass Lernen auch immer mit Arbeit verbunden ist. „Lernen muss erfolgreich sein!“, das ist die Devise der Autoren. Und sie beschreiben die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür. Ein Satz aus der Zusammenfassung dazu: „Lernen braucht Struktur, Lernen braucht Wiederholung! Nur das ständige Wiederholen führt dazu, dass aus flüchtigem Wissen Können wird.“ Meine Anmerkung: Leider gerät das, auch durch die grassierende Kompetenzeritis, in Vergessenheit.
Im Kapitel 2 geht es um Erkenntnisse der Lernpsychologie. Man erfährt hier Nützliches darüber, wie sinnvoll gelernt werden kann. Es kommt auch auf die emotionale Bewertung des Lerngegenstandes an. Da können auch Trainer einen wichtigen Beitrag leisten. Kapitel 3 befasst sich mit dem Lernen aus Sicht der aktuellen Gehirnforschung. Ich finde diesen Teil sehr gelungen, meine aber auch, dass die Grundsätze, die ich aus meiner Studienzeit in Erinnerung habe (da war das allerdings nur ein Randthema, Literatur: Frederic Vester), auch heute noch gelten. Wenn man etwas lernen will, muss der Stoff zunächst vereinfacht werden. Es kommt darauf an, dass die einfachen Abläufe richtig sitzen, also automatisiert ablaufen. Das geht nur mit Wiederholungen. Heute wird das oft als überholt angesehen. Dass ich die Basisfertigkeiten so gut beherrsche, verdanke ich auch meiner Urgroßmutter, die mich bei den Hausaufgaben immer mehr Wiederholungen machen ließ, als der Lehrer aufgab. Im Kapitel 4 steht der Teufelskreis im Lernprozess am Anfang. Es wird betont, dass es auf positive Gefühle ankommt und darauf, dass schnell erste Erfolge für die Kinder erlebbar sind. Die Praxisbeispiele dazu erinnern mich an einige meiner Schüler. Im Kapitel 5 werden die Lernmethoden behandelt. Konzentration auf ein Thema, auf der niedrigsten Ebene ansetzen, Lernkärtchen einsetzen, kleine Portionen regelmäßig üben, das sind Stichpunkte aus diesem Kapitel. Einzig skeptisch bin ich, wenn es darum geht, die Eltern einzubeziehen. Das ist sicher wichtig. Mir gelingt das leider nicht immer. Die besprochenen Maßnahmen gehen im Alltag oft unter. Manche Eltern sagen mir auch: »Ja, bei Ihnen macht der/die alles, aber zu Hause …« Die Autoren geben Tipps, was man im Elternhaus tun kann. Besonders gefallen haben mir auch die Ausführungen über das Loben und die Beschreibung der „Fallen“, in die Eltern oft hineintappen. Da werden sicher einige Eltern recht nachdenklich werden. Als externer Trainer übe ich – von Ausnahmen abgesehen – nur einmal pro Woche mit den Kindern. Für ein häufigeres Üben sind die Eltern vonnöten. Für mich ist die Lektüre dieses Buches Anlass, darüber nachzudenken, wie die Eltern besser einbezogen werden können. Zum Einsatz von Lernkärtchen, der von den Autoren beschrieben wird, werde ich die Eltern in Zukunft anleiten.
Aus der Praxis für die Praxis: Kapitel 6, 7 und 8, Förderung bei Schwierigkeiten im Rechen-, Lese- und Rechtschreiblernprozess: Besonders das Kapitel über die Förderung im Rechenlernprozess hat mich sehr interessiert. Vor Kurzem stellte ich bei einer Drittklässlerin während der Leseförderung fest, dass sie auch große Probleme mit Zahlen hat. Vier- oder fünfstellige Zahlen wurden mehr erraten als gelesen. Auf die Frage, was 7 plus 4 ergibt, herrschte Stillschweigen. 4 mal 7 war auch zu schwer. Ich habe Rechenkärtchen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erstellt, die inzwischen auch schon auf meiner Internetseite als Druckvorlage abgerufen werden können. Dabei habe ich auch auf Anregungen aus dem Buch von Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen, Kinder gezielt fördern, zurückgegriffen.
Die Autoren setzen sich in allen drei Kapiteln mit den nicht zielführenden Fördermaßnahmen auseinander. Sie erläutern sehr schön, wie jetzt auch wissenschaftlich mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen ist, dass Üben einen Einfluss darauf hat, wie das Gehirn arbeitet. Der Arbeitsspeicher muss entlastet werden, und das geht nur durch Üben. Vielleicht kann ich durch die Gewinnung von Mathepaten für Schulen hier noch einen Beitrag leisten. Allerdings kommt mir im Zusammenhang mit den beschriebenen Schwierigkeiten das Wort „Mathe“ etwas übertrieben vor. Es geht um die einfachsten Rechenschritte. Die Anregungen zur Unterstützung der Kinder sind für mich in allen drei Kapiteln gut nachvollziehbar und sicher für alle Eltern, die ihren Kindern wirksam helfen wollen, ein Gewinn.
Es ist sehr schwierig, am System Schule, am Lehrplan und an der Ressourcenzuordnung, etwas zu ändern. Vielleicht gelingt es den Eltern, über den Elternbeirat auf die Unterstützung durch Lese- und Rechenpaten, die ja auch von den Autoren gewürdigt wird, schon in den ersten Klassen hinzuwirken. Das wäre wenigstens ein kleiner Beitrag, um die Defizite, die sich auch aus der gesellschaftlichen Entwicklung ergeben, zu vermeiden.
Fazit: ein lesenswertes Buch mit guten Anregungen für Eltern. Auch ehrenamtlichen Lesepaten und -trainern für Grundschulkinder gibt dieses Buch eine Fülle von gut aufbereiteten Hintergrundinformationen und viele Tipps für die Praxis.
Gerhard Büttner und andere – Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb
Gerhard Büttner, Janin Brandenburg, Anne Fischbach, Marcus Hasselhorn – Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb – hogrefe
Das Buch beginnt mit zwei Fallbeispielen. Wer denkt, es gehe so praktisch weiter, liegt daneben. Danach geht es um die theoretischen Grundlagen, Definitionen und Operationalisierungen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Keine leichte Kost, aber, wer einen Überblick haben will, kommt auf seine Kosten. Diagnostik, beispielhafte Förderprogramme und die LRS-Erlasse der Bundesländer werden informativ dargestellt.
Dass ich bei der Darstellung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten nach der ICD-10 immer wieder Fragezeichen an den Rand schreibe, liegt nicht an unklaren Formulierungen der Autoren, sondern daran, dass ich von der ICD-10 nicht überzeugt bin. Wenn man einer bescheinigten Legasthenikerin in der 8. Klasse, die als austherapiert galt und die überhaupt nicht lesen konnte, in eineinhalb Jahren das Lesen beibrachte, sodass sie einen schriftlichen Einstellungstest einer großen Firma bestehen konnte, hält man von neurobiologischen Dysfunktionen nicht viel. Die Autoren schreiben dann auch, dass die Befunde studienübergreifend zeigen, dass Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nicht unüberwindbar sind. Allerdings treffe das nicht auf die Mehrheit zu, heißt es in diesem Zusammenhang.
Insgesamt ist das Werk für mich eine gute Auffrischung und Zusammenfassung gewesen. Manchmal war es etwas anstrengend zu lesen.
Christiansen, Andrea - Der Eltern-Guide bei Lernstörungen

DER ELTERN-GUIDE BEI LERNSTÖRUNGEN – Andrea Christiansen – humboldt – ISBN 978-3-8426-1750-6
Beim Lesen des Buches fiel mir schon sehr bald etwas ein, was ich vor kurzem in einer Gaststätte auf dem Land erlebt habe. Ich erkundigte mich nach den Fortschritten der kleinen Tochter der Wirtsleute. Das Kind war gerade in die Schule gekommen. Die Wirtin berichtete, dass das Kind unangenehm aufgefallen ist, weil es die anderen Kinder beim Reden ständig korrigierte: „Das ist doch falsch!“ Das Mädchen wies auf Grammatikfehler hin. Die Tochter der Wirtsleute war ständig mit Erwachsenen zusammen, nicht immer mit den Eltern, aber oft mit den Großeltern und anderen Verwandten bzw. Personal in der Wirtschaft. Sie beherrscht die Grammatik, ohne eine Regel zu kennen. Bei anderen Kindern in der Klasse war das offenbar nicht so.
Meine Wirtsleute hätten das Buch von Frau Christiansen nicht gebraucht, aber die Eltern vieler anderer Kinder. Frau Christiansen zeigt in ihrem Buch, auf was die Eltern aufpassen müssen, wenn ihr Kind sich natürlich entwickeln soll.
Mir gefällt auch der Rat, nicht auf die zu hören, die sagen, dass sich die Schwierigkeiten auswachsen werden. Jede Förderung sollte so früh wie möglich beginnen. Jedenfalls ist sie dann am effektivsten.
Im Kapitel „So lernt dein Kind“ gibt es eine Fülle von Hinweisen, die im praktischen Alltag nützlich sein können.
Frau Christiansen schreibt, dass es wenig sinnvoll ist, einfach mehr zu üben. Eltern brauchen eine Anleitung, und die erhalten Sie in dem Buch auf vielen folgenden Seiten auch. Die Ausführungen sind, denke ich, für Eltern gut nachvollziehbar, und ich kann viele Ausführungen mit meiner Erfahrung unterstreichen. Die Autorin hat aber ein viel breiteres Einsatzgebiet als ich, weshalb für mich einige Hinweise interessantes Neuland waren.
Bei der Automatisierung der Rechtschreibung hat mich ein Rat erstaunt: Das Kind soll sich das Wortbild auf einer imaginären Tafel einprägen und später dann auch von rückwärts von dieser Tafel ablesen können. Also, ich kann das nicht. Und ich bin ein sehr guter Rechtschreiber. Über Rechtschreibung muss ich sehr selten nachdenken. Man muss halt schauen, welche Methode für das Kind passt. Frau Christiansen weist jedoch darauf hin, dass visuelles Lernen den Kindern vieles einfacher macht, was auch die Wissenschaft bestätigt. Rechtschreibung wird allerdings heute ganz anders gelehrt als früher. Dazu schrieb ich einen Blog: Rechtschreiberwerb ohne Ende. Mit der geschilderten Technik hatte ich bisher keine Erfahrung und habe sie bei meinen Schülern auch nie gebraucht.
Für mich kommt es einfach darauf immer an, je nach Stand des Kindes, richtig zu üben. Daher tu ich mich bei der Definition von Legasthenie schwer. Ob man die verschiedenen Legasthenie-Begriffe überhaupt sauber abgrenzen kann, das bezweifle ich nach der Förderung von mehr als 120 Schülern. Genau so geht es auch der Autorin, die am Ende des Kapitels sagt, dass sie die verschiedenen Begriffe und die dazu aufgeführten Erklärungen nicht besonders mag. Sie legt besonderen Wert auf eine Abklärung der Ursachen, damit gezielt gefördert werden kann.
Als „Lesekoch“ habe ich eine spezielle Anmerkung zu den Silben. Frau Christiansen ist bei der phonologischen Bewusstheit auf der Linie der Schulbücher, die die Trennsilben des Duden auch als Sprechsilben verwenden. Dabei werden Laute getrennt. Bei Kat-ze wird das t aber nicht gesprochen. Das tz ist eine Verschriftung des Lautes z und wird nur als z gesprochen. Ähnlich die „Klas-sen-leh-rer-in.“ Ein Lob von mir für die Abweichung vom Duden am Wortende! Aber das Doppel-s wird wie ein s gesprochen. Also „Klass-en-leh-rer-in“. Abweichungen vom Duden gibt es in den Schulbüchern schon bei a-ber oder E-sel. Ich freue mich, wenn von den nur an der Worttrennung am Zeilenende orientierten Duden-Silben für die Leseförderung immer mehr abgewichen wird. Wörter wie Katze kann man nur als Kat-ze klatschen, wenn man die Trennung des Worts vorher geübt hat. Bei dem Laut ng wird das noch deutlicher. Und, wie Frau Christiansen zeigt, Leh-re-rin würde niemand von sich aus so sprechen oder klatschen.
Angenehm überrascht bin ich darüber, dass ich als „Lesekoch“ auf Seite 105 mit meiner Entdeckung, dass viele Kinder dazu neigen, von rechts lesen zu wollen, zitiert werde. Leider findet man meine Internetadresse aber nicht, wie angekündigt, im Anhang. Aber „Lesekoch“ reicht, um mich im Internet zu finden. Über dieses Thema kommen immer wieder Eltern auf meine Seite. Siehe meinen Blog: Phänomen – Leseversuche von rechts.
Ich wünsche der Autorin viel Erfolg bei ihrer Arbeit!
November 2024 – Siegbert Rudolph
Ronald D. Davis - Legasthenie als Talentsignal
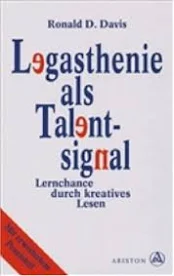
Davis – Legasthenie als Talentsignal
Ronald D. Davis – Legasthenie als Talentsignal – Lernchance durch kreatives Lesen – Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München – 1998
Der Titel hat mich gereizt, zumal ich ihn schon oft im Internet gelesen habe. Schon auf den ersten Seiten wurde mir klar, dass das bisschen Geld für das Taschenbuch hinausgeworfen war. Bereits das Geleitwort von Vera F. Birkenbihl trug dazu bei. Sie schreibt, dass das Problem (Anm.: Legasthenie) lösbar sei, wenn die Betroffenen ihre geniale Fähigkeit begreifen und als Stärke ausbauen können. Das ist eine Binsenweisheit, denn Stärken auszubauen, das ist generell wichtig. Im Zusammenhang mit der Legasthenie führt es aber leider oft dazu, dass man sich gar nicht bemüht, die Schwäche zu beseitigen. Dafür Zeit zu investieren, lohnt aber die Mühe!
Und wieso dieses Werk „bahnbrechend“ sein soll, das bleibt mir ca. 250 Seiten lang ein Rätsel. Ich finde, dass das Buch praxisfern und teilweise unlogisch ist. Der Autor geht davon aus, dass Legastheniker eine „besondere Wahrnehmung“ haben, und bildet zur Veranschaulichung 40 verschiedene Möglichkeiten ab, wie das Wort „ROT“ von Legasthenikern gesehen werden könnte. Jeder „meiner“ Legastheniker kann mir jeden Buchstaben eines Wortes, das er falsch gelesen hat, einwandfrei identifizieren, auch die berühmten Buchstaben b und d, die beim Lesen verwechselt wurden. Zum Schluss gibt es allerdings praktische Tipps. Man erfährt, dass Legastheniker dazu neigen, zu schnell zu lesen, und dass man die Buchstaben durch Modellieren mit Knetmasse erlernen kann. Warum man sich dann aber vorher über viele Seiten mit nonverbalem Denken und Desorientierung durch Wörter wie „ab, auch oder das“ beschäftigen muss, das bleibt mir ein Rätsel. Fazit: Auch hier kommt man durch Üben ans Ziel. Wie würde Shakespeare sagen: „Much ado about [almost] nothing.“
Diemer, Pronold-Günthner, Stang - Rechtschreibung für Eltern
Diemer, Pronold-Günthner, Stang – Rechtschreibung für Eltern
Rechtschreibung für Eltern – So unterstützen Sie Ihr Kind – Kirstin Diemer, Friederike Pronold-Günthner, Christian Stang (Hrsg.), Klett Lerntraining – ISBN 978-3-12-926092-0
Auf dem Cover steht noch „Das praktische Elternhandbuch“ und „Rechtschreibung ganz einfach!“. Ersteres kann ich bestätigen. Die zweite Aussage nicht. Ich finde, dass das Buch gut gemacht und auch hilfreich ist. Allerdings – und das ist von den Autoren sicher nicht beabsichtigt – kann man das Elend des derzeit gültigen Lehrplans kaum besser demonstrieren.
Es erschließt sich mir nicht, warum der Herausgeber in seinem Vorwort schreibt: „… und letztlich hoffe ich auch immer, durch meinen eigenen Werdegang ein bisschen Mut zu machen. So schrecklich kompliziert ist die deutsche Rechtschreibung nun auch wieder nicht. Ich habe auch nicht studiert und bin dennoch gut in Rechtschreibung. …“ Also, was soll das Wort „auch“ im letzten Satz bzw. der letzte Satz überhaupt? Außerdem: Ob etwas für ein Kind kompliziert ist oder nicht, das hängt vor allem davon ab, wie man es an die Sache heranführt, und nicht davon, ob es später mal auf die Uni geht oder nicht.
Dem Buch vorangestellt ist ein hilfreicher Überblick über verschiedene Methoden des Schriftspracherwerbs. Die Behauptung, dass lernschwächere Schüler eher von stärker strukturierten Angeboten wie dem Fibellehrgang oder dem silbenanalytischen Konzept profitieren würden, kann ich voll unterstreichen. Aber ich behaupte allerdings, dass stärkere Kinder davon nicht benachteiligt werden. Schließlich habe ich das Lesen nach der Fibel gelernt.
Hilfreich ist die Kombination mit PDF-Arbeitsblättern auf der Internetseite des Klett-Verlages.
In der ersten und zweiten Klasse sollen Kinder lauttreue Wörter richtig verschriften. In den Geschichten, die die Kinder schreiben sollen, sind sie aber nicht auf diesen Wortschatz beschränkt. Deswegen sollen sie andere Wörter so schreiben, wie sie sie hören. Rechtschreibregeln lernen sie erst später. Und deshalb, das wird auch sehr schön beschrieben, sollen die Eltern mit den Kindern nur ganz bestimmte Wörter üben, z.B. nicht „Sonne“, weil da nur ein „n“ zu hören ist. Die entsprechende Regel lernen die Kinder erst später. Ein Dilemma ist, dass auch Dialekt gesprochen wird. Die Übungsblätter im Download-Bereich des Klett-Verlages geben da Hilfestellung.
Das Buch fängt mit dem Schuleintritt an und baut dann nach und nach die Rechtschreibung weiter aus. Die Regeln werden gut erklärt, aber es sind eben sehr viele Regeln. Und manchmal treffen mehrere für ein Wort zu. Zudem erschließt sich die richtige Schreibung vieler Wörter nicht durch Regeln. Das sind dann die Merkwörter, die herkömmlich geübt werden sollen. Zwei Zitate zu diesem Dilemma:
Seite 42: „Damit Merkwörter im inneren orthografischen Lexikon abgespeichert werden, muss ihre Schreibung automatisiert werden. Dies gelingt am besten durch häufiges Schreiben. …“ Anmerkung von mir: Das trifft auf alle Wörter zu!
Seite 58: „Rechtschreiben darf nicht ausschließlich isoliert mit entsprechenden Materialien geübt werden, denn nur wer selbst Texte verfasst, lernt richtig schreiben. … Das Verfassen kleiner Geschichten oder Aufsätze mit anschließender Überarbeitung ist ein gutes Rechtschreibtraining, denn hier fallen Üben und Anwendung zusammen.“ Dies ist eine Anlehnung an den Lehrplan. Die Autoren modifizieren den Bayerischen LehrplanPLUS sogar positiv durch die Wörter „nicht ausschließlich“. Im LehrplanPLUS für die Grundschule in Bayern heißt es auf Seite 33 nämlich: „Rechtschreibübungen finden nicht isoliert und ohne Anwendungsbezug statt, sondern eingebunden in sinnvolle Kontexte wie das Verfassen und Überarbeiten eigener und gemeinsamer Texte.“ Wir haben die Wörter früher zehnmal geschrieben. Das ist heute verpönt. Heute sollen die Kinder den Stoff mehr erproben, untersuchen und damit experimentieren. Die Folge: Die Regeln sitzen nicht. Die Autoren schreiben zu Recht (Seite 85), dass viele Kinder beim Diktat in Zeitdruck geraten und in der vorgegebenen Zeit aufgrund von Rechtschreibunsicherheiten nicht in der Lage sind, die richtigen Strategien zu finden.
Aber, für den Lehrplan können die Autoren ja nichts. Deshalb ist das Buch unter den gegebenen Umständen bestimmt eine Hilfe für Eltern. Nur: Einfach ist anders! (Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich für diesen Lehrplan auch keine einfache Lösung habe.) Die vielen Regeln mit den vielen Ausnahmen sind für viele Kinder verwirrend. Ein Kind ist kein Computer, der die vielen Möglichkeiten enumerativ durchgeht und alle Ausnahmen berücksichtigen kann. Der Lehrplan sieht vor, dass es wichtiger ist, von Anfang an Geschichten zu schreiben, statt zuerst den Wortschatz zu erlernen. Was am Anfang an Zeit für die Rechtschreibung gespart wird, können viele Kinder später nicht mehr aufholen. Manche Eltern oder auch Lehrer geben sich – Pareto lässt grüßen – mit den berühmten 80 Prozent oder sogar noch weniger zufrieden.
Dürre, Rainer - Legasthenie
Rainer Dürre, Legasthenie – das Trainingsprogramm für ihr Kind, Verlag Herder 2012
Im Text auf dem Umschlag wird darauf hingewiesen, dass der Autor sein Trainingsprogramm auf Basis des „rhythmisch-silbierenden Mitsprechens“ entwickelt hat. Das ist schon mal sehr sympathisch. Außerdem arbeitet der Autor nur mit Einzelförderung. Dazu auf Seite 29: Jedes Kind hat seine eigene Legasthenie, deshalb sind Gruppen, auch wenn nur zwei Kinder in der Gruppe sind, nicht gut. Seine Erfahrung: „Während wir aufgrund des Einzeltrainings nach 15 – 18 Monaten mit unserem Training fertig sind und das Kind beruhigt gehen lassen können, dauert es in Instituten mit Gruppenarbeit teilweise drei bis vier Jahre, ohne dass die Schüler mit dem gleichen Erfolg wie nach unserem Einzeltraining aufhören können.“ Auch meine Erfahrung ist, dass das Einzeltraining, bei dem man sich als Trainer genau auf den Schüler konzentrieren kann, am erfolgreichsten ist.
Eingegangen wird intensiv auf die Blicksteuerung. Es wird über das Freiburger Blicklabor gesprochen. Seite 43: „Die Blicksprünge werden an das Gehirn weitergeleitet und vom Gehirn zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Genau das geschieht auch beim Lesen. Hier müssen die Blicksprünge vom Gehirn jedoch sehr genau gesteuert werden. Nur so kann jeder Blicksprung dann erfolgen, wenn er für den Leseprozess gebraucht wird. Geschieht dies nicht, können Buchstaben übersprungen oder auch verwechselt werden, fallen Wortendungen weg oder das Kind verrutscht in der Zeile.“ Meine Beobachtung ist da ganz anders: Ich stelle immer wieder fest, dass die Schüler verzweifelt versuchen, Anker im Text zu finden, mit denen sie schnell etwas anfangen können. Und diesem Anker werden dann Wörter, wie z.B. die Artikel, oder Endungen einfach angepasst. Der Text wird einfach nicht genau entziffert, weil dazu die Übung fehlt. Die Lesetechnik ist einfach nicht komplett entwickelt.
Auf Seite 48 wird über die Arbeit von Optometristen berichtet, die die Augen untersuchen. Bei einem Jungen sollen Aussetzer eines Auges Schuld an dessen Leseproblemen gehabt haben. Die Augen befanden sich sozusagen an unterschiedlichen Textstellen und deshalb kam es zu Auslassungen usw.
Das Trainingsprogramm, das viel Raum im Buch einnimmt, enthält gute Hinweise und ergänzende Übungen zum Lesemotivationsprogramm.
Freimuth, Ingrid – Lehrer über dem Limit
Freimuth, Ingrid – Lehrer über dem Limit
Ich denke, dieses Buch hat unsere Republik gebraucht. Die Autorin wagt sich, so manche Entwicklung im Zusammenhang mit Flüchtlingen kritisch anzusprechen, ohne den Verdacht der Fremdenfeindlichkeit zu erwecken. Sie macht deutlich, wie mit unserer sozialstaatlichen Fürsorge vielen Leistungsempfängern die Eigeninitiative abtrainiert wird, mit der sie auch selbst für sich sorgen könnten. Sie kritisiert den völligen Verzicht auf Sanktionen im Bereich Erziehung und Bildung und dass man so tut, als wäre der Verzicht auf Sanktionen der einzig zielführende Weg, um permanent Regeln verletzende Menschen zu sozialverträglichen Verhalten zu bewegen. Die Beispiele, die sie bringt, gehen teilweise unter die Haut. Insbesondere die Schilderung der Verhaltensmuster aufgrund von Kämpfen um höhere Rangordnungsplätze eröffnete mir eine völlig neue Sicht. Es wird deutlich, wie weltfremd Behörden agieren, etwas, das auch ich in meinem bescheidenen Erfahrungsfeld so wahrnehme. Die Autorin geißelt mit überzeugenden Beispielen die überzogene politische Korrektheit. Gut finde ich, dass nicht nur auf Probleme hingewiesen wird, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung genannt werden. Der Epilog enthält eine Liste mit Punkten, die zeigen, wie wir den Einwanderern bedingungslos in einem ihre Wertvorstellungen akzeptierenden Entgegenkommen und fast unbegrenzter materieller Versorgungsbereitschaft begegnen. Es folgt auch noch ein Katalog mit Maßnahmen von der Bindung der Förderung an Mitarbeit bis hin zur Ausbildung der Lehrer und zur Schaffung von institutionellen Sanktionen im Bildungswesen. Ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, an vielen Stellen am Rand Zustimmung vermerkt, und hoffe, dass es, wie die Autorin wünscht, die Diskussion zum Thema Integration erfrischend belebt.
Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen
Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen
Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern – Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis – 6. Auflage – ISBN978-3-8344-3503-3 – Persen Verlag
Das Buch richtet sich zwar an Grundschullehrer, aber ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich einfach mehr über das Thema Rechenschwäche wissen wollte. Es hat sich gelohnt.
Der Autor zeigt deutlich auf, wo Verständnisprobleme bei Kindern liegen können, und erklärt, wie man zum richtigen Verstehen bzw. Rechnen kommen kann. In der Vorbemerkung schreibt der Autor, dass er bei seiner Förderarbeit erschreckend oft den Eindruck gewinnt, dass „rechenschwachen“ Kindern bisher einfach die Förderung gefehlt hat. Das deckt sich mit meiner, auf diesem Gebiet allerdings noch ganz geringen Erfahrung. Meine Meinung: Das ist genau wie beim Lesen. Wenn die grundlegenden Einsichten fehlen bzw. die Basisfertigkeiten nicht sitzen, führt das zwangsläufig zu einer Schwäche, die manchmal (wahrscheinlich sogar oft) auch als Störung diagnostiziert wird.
Gut gefallen hat mir, dass alle Kapitel gleich gegliedert sind, wobei insbesondere die beiden Punkte „Was könnte Kindern in diesem Bereich schwerfallen und warum?“ und „Anregungen für Unterricht und Förderung“ besonders wichtig sind. Gerade das erste Kapitel hilft, die Schwierigkeiten der Kinder besser zu verstehen. Die Anregungen sind einleuchtend dargestellt. Das Buch ist auch für Trainer interessant, die sich erstmals mit Rechenförderung beschäftigen. Viele Vorschläge werde ich in meine Förderung übernehmen.
Ziffernwürfel mit 10 Flächen werde ich mir besorgen. Es wird gewürfelt, und das Kind soll sagen, was „um eins weniger oder mehr“ ist. (Später kann man diese Würfel natürlich auch für Plus- und Minusaufgaben sowie für das Einmaleins einsetzen.)
Ich habe für die Zerlegung von Zahlen bisher nur Kärtchen für die Zehnerzerlegung im Einsatz. Ich werde aufgrund der Anregung im Buch auch die Zahl 5 entsprechend aufbereiten und damit üben. Außerdem werde ich, wie später im Buch auch angeregt, Zerlegungskärtchen für die Zahlen 6 bis 9 erstellen. Die Kärtchen stehen auf meiner Internetseite als Schneidvorlage im Downloadbereich zur Verfügung: Übungen herunterladen / Rechnen / Rechenkärtchen – Druckvorlagen.
Der Autor betont (Seite 69), dass auch im Zeitalter des Taschenrechners und des Computers rechnerische Grundfertigkeiten erworben werden müssen. Er fragt, wie man sonst Eingabefehler in einen Rechner feststellen kann. Ich vermute, dass viele Kinder zwar das Einmaleins einmal gekonnt haben, aber dass es nicht oft geübt wurde. Es sitzt nicht. Der Autor hält es für wichtig, dass die Kinder mathematische Denkweisen verstehen müssen, bevor die Rechenvorgänge automatisiert werden.
Der Autor fordert auch immer wieder dazu auf, die Kinder eigene Aufgaben konstruieren zu lassen.
Viele Übungsanregungen gibt es zum Thema „Zerlegen von Zahlen“. Ich habe das bisher nur mit der Zahl 10 gemacht. Ich werde weitere Kärtchen erstellen. Auf der Vorderseite steht dann z.B. oben die 9, darunter die 5, das Zeichen „+“ und ein freies Feld. Auf der Rückseite steht das Ergebnis, falls das Kind alleine trainiert oder mit einer Person, die auf diesem Gebiet nicht firm ist. Die Karten werden dann – und diese Anregung hatte ich auch schon aus dem Buch „Lernen mit Grundschulkindern“ entnommen – nach und nach in der Kartei nach hinten befördert. Was nicht sofort gewusst wird, wird geübt und bleibt zunächst im Ausgangsfach. Ich lasse meine Schülerin für die nicht gekonnte Aufgabe ein zusätzliches Kärtchen manuell erstellen.
Empfohlen wird auch das Arbeiten mit einer Kugelkette als Grundmaterial für das Zahlenzerlegen. Das habe ich auch schon so gemacht. Die Methode ist wirklich empfehlenswert. Ich habe mir das Material dazu auf einem Stand beim Legastheniekongress erstanden.
Gefallen haben mir auch die Hinweise zu den „Schönen Päckchen“. Danach sollen die Kinder z.B. Reihen ergänzen. Also z.B. 9 = 8 +1, 7 + 2 … Man kann, um einer Schematisierung vorzubeugen, auch Störungen einbauen. Die Idee mit den Störungen habe ich sofort in meine bereits erstellten Übungen eingebaut.
Auf den Seiten 97/98 wird empfohlen, die Automatisierung immer nur wenige Minuten zu üben, aber nach ca. 20 Minuten eine Wiederholung vorzunehmen.
Interessant für mich war auch die Übung, die auf Seite 98 vorgestellt wird, nämlich das Automatisieren von Nachbarzerlegungen (6 = 5 + _ und 4 + _).
Auf Seite 102 werden Subtraktionskärtchen vorgestellt. Vorne: 9 – 6. Hinten 9 darunter 6 + _. Solche Kärtchen werde ich mir auch erstellen.
Ausführlich mit Hinweisen für mögliche Missverständnisse und mit guten Vorschlägen für das Üben wird auch das Verdoppeln und Halbieren behandelt.
Auf Seiten 140 ff werden Zahlenmauern als Übungsmöglichkeit vorgestellt. Ich werde mir entsprechende Kärtchen dafür erstellen. Je nachdem, wie hoch die Mauer werden soll, werden dann auch zweistellige Zahlen gebraucht. Das Buch enthält aber auch Kopiervorlagen dazu. Auch den Übungsvorschlag „Zahlenketten“ (Seite 143) werde ich mit meiner Schülerin ausprobieren. Ebenso das Rechendreieck (Seite 145).
Sehr schön finde ich auch das Kapitel über die Zehner und Einer.
Nicht behandelt werden Multiplikation und Division.
Fazit: Alles ist leicht verständlich und doch nicht langweilig. Man kann sich gut in das Thema einarbeiten und erhält viele nützliche Anregungen für die Förderung von rechenschwachen Kindern. Die vielen konkreten Hinweise für Grundschullehrer haben mich nicht gestört. Sie sind oft auch für Trainer nützlich.
Gailberger, Steffen - Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler
Steffen Gailberger – Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler – Zur Wirkung von lektüre-begleitenden Hörbüchern und Lesebewusstmachungsstrategien – 2013 BELTZ JUVENTA – ISBN 978-3-7799-2973-7
Auf dieses Buch bin ich durch eine Recherche über den Einsatz von Hörbüchern zur Leseförderung gestoßen, weil ich mich mit dem Gedanken beschäftige, für meine Schüler als Ergänzung zum Lesemotivationstraining Hörbücher einzusetzen.
Wer sprachlich starken Tobak liebt, ist mit diesem Buch gut bedient. Gleich auf Seite 16 findet sich ein tolles Beispiel:
„Karmiloff-Smith betont, dass erreichtes Können nie als eine situative Performanz von Schülerinnen und Schülern missverstanden werden darf, sondern vielmehr als eine nachhaltig-übertragbare Kompetenz darzustellen und zu fördern ist, die (im besten Fall) bis zu einem expliziten Bewusstseinslevel erfolgreich weiter zu fördern ist. Nur so könne garantiert werden, dass domänenspezifische Kompetenzen (wie eben das Lesen) – in verschiedenen Mustern vorhanden – auch wirklich auf neue Problemlösungsanlässe übertragen werden können. Lesende weisen dies nach, wenn sie systematische Zugriffsmöglichkeiten auf Texte nutzen und damit zeigen, dass sie aus verschiedenen potenziellen, jeweils diejenigen Alternativen auswählen können, die am ehesten Erfolg versprechen.“
In aller Ehrfurcht vor dieser Formulierungskunst: Meine Kompetenz reicht nicht aus, um zu verstehen, was genau der Autor sagen will. Vielleicht das: Wer nicht nur einen Artikel lesen kann, sondern mehrere, der verfügt über eine Lesekompetenz?
An verschiedenen Stellen im Buch, z.B. auf Seite 19 und auf den Seiten 54, 55 und 56 wird behauptet, dass Leseschwäche besonders in sozialen Brennpunkten vorkommt. Sie kommt in ganz Deutschland vor, in allen Schichten, und auch in anderen Ländern. Das lässt darauf schließen, dass es neben den sozialen Gründen auch andere, die vielleicht mit dem Leselernprozess selbst zusammenhängen, geben muss.
Völlig zu Recht weist der Autor aber darauf hin, dass Leseanimationsmaßnahmen bei leseschwachen Schülern kaum bis gar keine Wirkung zeigen. Wer nicht gescheit lesen kann, dem kann man auch keine Lust auf das Lesen machen. Und dass es immer mehr Schüler werden, die Leseschwierigkeiten haben, das legt der Autor überzeugend dar.
Als eine Maßnahme zur Förderung der Lesefertigkeit wird das Hörbuch beschrieben. Dem ist nur zuzustimmen.
Im Buch wird das Lüneburger Modell beschrieben und in diesem Zusammenhang einiges zum Kompetenzbegriff ausgeführt. Für mich war das hochinteressant, weil ich bislang nicht wusste, woher die inflationäre Verbreitung des Kompetenzbegriffs kommt. Man erfährt, dass die Durchsetzung dieses „neuen Paradigmas“ im Zuge von PISA 2000 beschlossen und „top-down“ eingeführt wurde.
Franz E. Weinert hat 2001 im Auftrag der OECD die gängigen Kompetenzbegriffe gesichtet und zu einer Synthese zusammengefasst: „Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“
Der Autor bricht dann diesen stark kondensierten und auch nach seiner Meinung für Lehrende und Studierende alles andere als leicht verständlichen Satz auf das Thema Lesen herunter. Ich formuliere das mal für mich um: Wissen und Fertigkeiten werden dann zu Kompetenzen, wenn man damit immer wieder andere Probleme motiviert, willentlich und verantwortungsvoll lösen kann. Persönlich halte ich hier – wie in vielen Fällen – die Kompetenzorientierung für reichlich gestelzt. Und was dieser Kompetenzbegriff für das Lesen bedeutet, das dürfte spannend werden. (Ich frage mich zunächst, ob es etwas mit Kompetenz zu tun haben kann, wenn ich einen Krimi lese? Wahrscheinlich schon, denn ich löse damit das Problem, dass mir langweilig ist oder ich Ablenkung vom Schulstress brauche.)
Lesekompetenz wird immer auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachtet:
• dem Lesen auf Prozessebe – diese Ebene wird in Kompetenzstudien betrachtet
• dem Lesen auf der Subjektebene – hier geht es um Motivation, Emotion und Wissen
• dem Lesen auf der sozialen Ebene – was beeinflusst individuell: Familie, Schicht, Ethnie
„Allein die Fähigkeit des Lesens an sich zu besitzen, hat so lange nichts mit Kompetenz und Kompetenzausübung (und damit auch mit möglicher Kompetenzsteigerung) zu tun, solange Schülerinnen und Schüler diese als träge Fähigkeit zwar besitzen, sie aber unter handlungsbezogenen Gesichtspunkten weder aktiv anwenden noch fundieren, noch von ihnen profitieren. Zu einer erkennbaren Kompetenz wird diese ´unsichtbare´ Fähigkeit erst im konkreten Leseereignis, das heißt durch die motivational terminierte und volitional gesteuerte, wiederholte Anwendung, aus der wir wiederum auf latente Kompetenzen rückschließen können.“ Meine Güte: Wie kompliziert kann man die Welt machen. Ich frage mich ernsthaft, ob ich das bei meiner praktischen Arbeit brauche. Dass ich meine Schüler motivieren muss, das war mir von Anfang an klar, und dass die Schüler lesen lernen wollen müssen, ist die Folge davon. Und dann üben, wiederholen und vertiefen wir so lange, bis die Lesefertigkeit sich deutlich verbessert hat.
Bestätigt fühle ich mich auf Seite 54/55: Bei schwach lesenden Schülern bringt es gar nichts, wenn diese leise viel lesen. Das sage ich allen Eltern. Es kommt darauf an, durch langsames, vom Trainer oder Lesepartner kontrolliertes Lesen zur Lesegenauigkeit zu kommen. Danach kommt dann die Steigerung der Lesegeschwindigkeit. Ob man dann von Kompetenz spricht oder nicht, ist für mich unerheblich.
Ich habe einige Passagen übersprungen, weil ich die für meine Arbeit nicht brauche.
Völlig zu Recht stellt der Autor auf Seite 117 fest: „Wer noch in der Sekundarstufe 1 nicht über eine ausreichende Leseflüssigkeit verfügt, wird schwerlich in der Lage sein, seine mangelnde Lesekompetenz alleine und auf sich gestellt zu verbessern.“ Ich füge hinzu: … nicht über eine ausreichende Leseflüssigkeit bzw. Sicherheit verfügt … Denn manche Schüler lesen flüssig, aber sie lesen nicht genau das, was geschrieben steht. In den Mittelschulen schwankt der Anteil der leseschwachen Schüler zwischen 20 und 30 Prozent.
Interessant sind die Ausführungen über den Einsatz von Hörbüchern im Deutschunterricht im Rahmen des Lüneburger Modells. Es wird darauf hingewiesen, dass die Hörbücher die Interessen der Schüler treffen müssen. Geeignete Bücher werden besprochen.
Die Methoden des Wiederholten Lautlesens und des Begleitenden Lautlesens im Rahmen des Lüneburger Modells werden vorgestellt. Als Trainer praktiziere ich beides mit meinen Schülern. In der Einzelförderung kann ich natürlich leicht das machen, was ansonsten eine Wahnsinnsaufgabe für den Lehrer ist: den Schüler individuell zu fördern.
Hörbücher fördern die Leseflüssigkeit. Das ist belegt. Ich will das Hörbuch zum Lern-Hörbuch weiterentwickeln. Dabei soll der Schüler, ohne auf die Technik achten zu müssen, den Beginn des Vorlesens eines jeden Satzes selbst bestimmen. Er kann dann entweder mit dem Ton mitlesen oder aber nach seinem Leseversuch kontrollieren, ob er richtig gelesen hat.
Im Buch werden noch viele Aspekte behandelt, die ich aber nur überflogen habe, weil ich sie bei meiner individuellen Einzelförderung nicht brauche.
Ganser - Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
Ganser – Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – tolles Buch
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Diagnose – Förderung – Materialien – Ein Fortbildungsmodell der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen – Gesamtleitung und Gesamtredaktion: Bernd Ganser – Auer Verlag GmbH, Donauwörth
Dieses Sammelwerk hat es in sich. Eine Fachlehrerin hatte es mir geliehen. Ich wollte es mir ansehen und dann entscheiden, ob ich mir ein Exemplar kaufe. Aber ich war schon von der ersten Seite so fasziniert, dass ich beschloss, meine Notizen in dieses Exemplar zu schreiben und dafür das neue Buch zurückzugeben.
Das Buch ist ein Sammelwerk und bietet einen sehr guten Überblick und viele Detailinformationen zum Thema. Es ist angereichert durch anschauliche Beispiele, die ich zum Teil auch in meinem Programm berücksichtigt habe. Ich werde in dieser Buchbesprechung auch meine persönlichen Erfahrungen einfließen lassen.
Für mich am wichtigsten sind die Beiträge von Bernd Ganser und Renate Valtin. Gleich auf der ersten Seite des ersten Kapitels „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Folgen eines gestörten Lernprozesses?“ stand ein Satz, der mich in einen Zustand versetzte, den Rest des Buches wie einen Roman verschlingen zu können:
„Eine Differenzierung der beiden Gruppen (Legastheniker und Lese-Rechtschreib-Schwäche) leistet daher keinen besonderen Beitrag, wenn es darum geht, die besonderen Schwierigkeiten, die das Lesen- und Rechtschreiblernen manchen Kindern bereitete, zu analysieren. Zitat Klicpera und Gasteiger-Klicpera 1993.“ Das stimmt mit meinem „Weltbild“ überein, denn über die Einteilung in Legastheniker und Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche habe ich schon viel gelesen, und diese Klassifizierung hat mich in keiner Version überzeugt.
Auf alle meine Schüler trifft das zu, was bei Bernd Ganser wie folgt steht: „Beim Lesen kann man annehmen, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder deshalb so viele Lesefehler machen, weil sie u.a. nur mit Schwierigkeiten in der Lage sind, Wörter in für sie erlesbare Segmente zu gliedern (visuell und auch akustisch). Es wird her vermutet, dass diese Kinder versuchen, das Wort als Ganzes zu lesen, was völlig misslingt, weil entsprechende Merkmalslisten im Langzeitgedächtnis fehlen oder ein ähnliches Wort gelesen wird, das dem zu lesenden in irgendeiner Weise ähnelt.“ Diese falsche Lesetechnik ist das Hauptproblem, zumindest bei meinen Schülern. (Es kommen gelegentlich noch Buchstabenverwechslungen hinzu, aber die konnte ich mit geeigneten, individuell zugeschnittenen Übungen „wegtrainieren“.)
Die nächste Autorin in diesem Sammelwerk, Renate Valtin´g schreibt zum gleichen Problem ab Seite 19: „Meine zentrale These lautet, dass die Lernenden beim Schriftspracherwerb zu einer gedanklichen Klarheit in Bezug auf Funktion und Aufbau der Schrift gelangen müssen. Ferner brauchen sie metakognitives Wissen in Bezug auf geeignete Lern- und Übungsstrategien sowie effektive Arbeitstechniken. Kinder mit Lernschwierigkeiten haben falsche Vorstellungen und unangemessene Strategien entwickelt als Ausfluss falscher Lehrstrategien; aber häufig sind sie auch deshalb zustande gekommen, weil Lehrer und Lehrerinnen zu wenig den Entwicklungsstand des Kindes kennen und berücksichtigen.“ Mir fehlt noch die Erfahrung, den Lehrprozess beurteilen zu können. Eines aber ist mir klar geworden: Die Klassen sind zu groß. Wie soll eine Lehrkraft auf jeden Schüler eingehen können? Mit Verwunderung habe ich einige methodische Dinge zur Kenntnis genommen, deren Sinnhaftigkeit sich mir noch nicht erschließt. Mir war neu, dass die Schüler heute zunächst phonetisch ohne Berücksichtigung der Rechtschreibregeln schreiben dürfen und dass Schönschreiben nicht mehr geübt wird. Ich hoffe, die Lehrer haben mehr Übung im Entziffern des Gekritzels, das es da oft gibt. Den Unterschied sehe ich bei einer Schülerin, die vor einem Jahr aus Rumänien kam und der ich helfe, schneller Deutsch zu lernen. Ihre klare, saubere Schrift ist ein echter Genuss.
Ich fühle mich richtig bestärkt durch Renate Valtin, wenn sie am Schluss dieses Absatzes feststellt: „Viel Resonanz in der Öffentlichkeit finden nach wie vor die Verfechter des „klassischen“ Legastheniekonzepts, die Legasthenie als spezielle Lese-Rechtschreib-Störung bei intelligenten Kindern definieren bzw. bei Kindern, bei denen eine Diskrepanz zwischen hohem IQ und schwachen Lese-Rechtschreib-Leistungen besteht. Die Legasthenie sei erkennbar anhand besonderer Fehler, der Reversionen (dies sind Verwechslungen spiegelbildlicher Buchstaben wie d-b, p-q oder Vertauschungen wie bei ie-ei), wobei angeborene bzw. ererbte Defekte des Kindes („Teilleistungsstörungen“) als Ursache angesehen werden. Das Konzept der klassischen Legasthenie ist jedoch weder sinnvoll noch brauchbar (s. auch Scheerer-Neumann 1997)“.
Ich gebe dazu eine ganze Passage auf Seite 26 wieder: „Man fragt sich, wieso das Funktionsmodell und das klassische Legastheniekonzept sich nach wie vor so großer Beliebtheit erfreuen, denn viele Gruppen berufen sich darauf, so zum Beispiel der „Bundesverband Legasthenie“, eine Interessenvertretung von Eltern „legasthenischer“ Kinder, aber auch Therapeuten und Lehrer. Dieses Konzept hat einerseits eine entlastende Funktion für die Beteiligten, Lehrer/innen, die sich auf Legasthenie, Teilleistungsstörungen oder MCD (Minimale Cerebrale Dysfunktion) berufen, können sich von Schuldgefühlen befreien, wenn sie die Ursachen für schulische Leistungsprobleme in Defekten des Kindes sehen. Andererseits ist das medizinische Modell auch nützlich. En nützt Eltern, wenn sie bem Ausbleiben schulischer Hilfen eine außerschulische Therapie für das Kind aufgrund „visueller oder auditiver Differenzierungsschwächen“ oder anderweitiger „Teilleistungsschwächen“ finanziert bekommen.“
Und weiter: „Fruchtbarer für diagnostische und therapeutische Zwecke erscheint die Erklärung der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten innerhalb eines Ansatzes, der das dynamische Wechselspiel sozial-familiärer, individuell-kognitiver und schulischer Faktoren berücksichtigt. LRS wird im Sinne Bergks nicht als Lernbehinderung, sondern als Behinderung des Lernens, nicht als Beeinträchtigung der Lernfähigkeit, sondern als Beeinträchtigung der Lernmöglichkeiten angesehen (Bergk 1980).“
Sigrun Richter schreibt sogar, Seite 46: „Diese Versuche – nämlich die Leseschwierigkeiten im Rahmen des Konstrukts „Legasthenie“ mit Funktionsstörungen zu erklären – können als gescheitert angesehen werden.“ Wenn ich im Internet nach Legasthenie suche, gewinne ich allerdings diesen Eindruck nicht. Die weit überwiegenden Fundstellen betreffen den medizinischen Ansatz.
Eine weitere interessante Feststellung, die mit meinen Erfahrungen übereinstimmt, zieht sich durch das Buch: Sigurn Richter schreibt auf Seite 50: „… dass sich Kinder gleichen Lebensalters auf unterschiedlichen Stufen befinden können und dass sie unterschiedlich viel Zeit brauchen, um die nächste Stufe zu erreichen.“ Später heißt es: „Es gibt keine allgemein gültigen Werte, wie lange ein Kind auf einer Stufe verbleibt, bis es den Sprung zur nächsten schafft.“ Und: „Leseschwierigkeiten lassen sich also unter der Perspektive der Entwicklungsmodelle zunächst als Verzögerungen im Lernprozess beschreiben, die sich allerdings zu Entwicklungsstörungen auswachsen können, wenn die Regeln des Entwicklungsprozesses nicht beachtet werden.“
Karin Olesch zitiert dazu eine These von Renate Valtin, nämlich „dass legasthenische Kinder auf unteren Ebenen der Schriftsprachentwicklung stehen geblieben sind, weil sie größere Hürden zu überwinden haben“ und die Lernanforderungen, die an die gesamte Klasse gestellt werden, keine optimale Passung mit ihren Lernvoraussetzungen haben.
Es gibt in diesem Buch nur einen Punkt, den ich nicht verstanden habe: Karin Olesch schreibt über die Bemühungen, ein Einstiegskonzept von der Sprache zur Schrift zu finden, und stellt dazu auf Seite 221 fest: „Der seit 1997 in Bayern durchgeführte Schulversuch „Phonetisches Schreiben“ versucht, diesem Ansatz gerecht zu werden. Im Mittelpunkt stehe daher die Hinführung aller Schüler zur Einsicht in die Struktur der Schriftsprache, um so Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorzubeugen.“ Und dann etwas später weiter: „Gerade die beim freien Schreiben entstandenen Produkte sind wertvolle Diagnoseinstrumente für die Lehrkraft, die nicht Defizite aufzeigen, sondern den erreichten Entwicklungsstand. So können gezielt Fördermaßnahmen für jedes einzelne Kind festgelegt werden, damit Lernblockaden vermieden werden und späteren Lernstörungen vorgebeugt wird. Da der individuelle Förderbedarf besonders deutlich wird, kann eine optimale Passung zwischen der Aneignungsstufe und dem Lernangebot erfolgen.“ Was dazu die Lehrer in der Praxis sagen, das würde mich interessieren. Ich habe den Eindruck, dass man es mit dieser Methode den Schülern zunächst zwar leichter macht und schnellere Erfolge erzielt, aber das geht wahrscheinlich zu Lasten vieler Kinder, die den Umschwung zur richtigen Schreibweise nicht schaffen.
Ulrike Passauer, Hedwig Rauch, Rita Schaller-Tzschope und Martina Oberhofer schreiben allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ins Stammbuch: „Ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Ziel beim Lesenlernen ist die Motivierung bzw. die Erhaltung der Freude am Lesen durch ein vielfältiges Angebot an Lesestoff (Seite 204).“ Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, und ich weiß, dass ich damit nicht alleinstehe!
Gloss, Werner - Auf Abwegen
Gloss, Werner – Auf Abwegen
Werner Gloss – Auf Abwegen – Wenn Jugendliche kriminell werden – Ch. Links Verlag – 2018 – ISBN 978-3-96289-017-9
Ein Aufklärungsbuch für Eltern – das ging mir beim Lesen durch den Kopf. Eltern von Heranwachsenden kann dieses Buch sehr empfohlen werden, auch wenn keine dunklen Wolken am Horizont sind. Die Sensibilität für alltägliche Geschehnisse zu Hause und im familiären Umfeld wird erhöht. Es ist beeindruckend, wie einfühlsam der Autor die Geschichten von Jugendlichen erzählt. Es wird nicht nur die Tat beleuchtet, sondern auch Hintergründe und Aktionen, die sich daraus ergeben. Eltern erhalten praktische Ratschläge, für den Fall, dass „die Welt aus den Fugen gerät.“ In einem Beispielfall wird geschildert, wie die Rechthaberei der Eltern erst dazu geführt hat, dass der Sohn endgültig auf Abwege kam. Das Buch zeigt, dass es nicht darauf ankommt, zu bestrafen, sondern dass den Jugendlichen Grenzen aufgezeigt werden müssen. Die Wert- und Normverschiebungen, die sich bei Jugendlichen manchmal entwickeln, sind zu korrigieren. Der Bericht eines Sozialarbeiters beleuchtet praktische Fälle aus einer ungewohnten Perspektive. Der Autor räumt mit der weitverbreiteten Ansicht auf, dass Kriminalität vererbt wird.
Juristische Fachausdrücke werden anschaulich und sehr verständlich erklärt. Wenn die juristischen Bücher, die ich im Studium lesen musste, nur halb so fesselnd geschrieben worden wären wie diese Erläuterung des Jugendstrafrechts, hätte mich die Juristerei sicher mehr interessiert. Allein die für viele sicher neuen Einsichten in die Polizeiarbeit machen das Buch schon lesenswert.
Zum Schluss konfrontiert der Autor den Leser mit einem Brief an „einen Zeitgenossen“. Das Thema ist nicht nur eines für betroffene Familien, sondern geht die ganze Gesellschaft an. Der Mensch ist nicht schwarz oder weiß. „Es sind die unterschiedlichsten Farb- und Grautöne, die eine Person ausmachen.“
Hengstschläger, Markus - Die Durchschnittsfalle
Markus Hengstschläger, Die Durchschnittsfalle – Gene – Talente – Chancen, Ecowin Verlag Salzburg, 2012
Das Buch macht Mut, von der Norm abzuweichen, und ist schon deshalb eine empfehlenswerte Lektüre. Es ist verständlich geschrieben, spannend und er- bzw. einleuchtend. Der Autor überzeugt mit guten Beispielen von seiner These, dass der „Durchschnitt die größte Gefahr für eine erfolgreiche Zukunft ist“.
Der Autor sagt wörtlich (Seite 175): „Jeder Mensch weist individuelle Begabungen auf. Der Mensch hat aber auch das Recht, seine Talente zu ignorieren beziehungsweise eventuell fehlende Leistungsvoraussetzungen durch größeren Einsatz, mehr Begeisterung und andere Begabungen zu kompensieren.“ Talente, so der Autor, kann man nicht messen. Messen kann man nur den Erfolg. Und der muss immer hart erarbeitet werden, ganz gleich, wie groß oder evtl. auch kleiner das betreffende Talent ist. „Üben, üben, üben“, rät der Autor auf Seite 70. Und das gilt meiner Meinung nach auch dann, wenn man Lesen lernen will.
Und diese Passage hat mich als Lesemotivationstrainer besonders fasziniert. Der Autor meint – allerdings ganz generell – auf Seite 71: „Zurzeit hat sich so etwas wie eine genetische Ausrede bei vielen Menschen manifestiert, und keiner traut sich so richtig dagegenzusprechen. Auch deshalb nicht, weil man diese kleine, aber entscheidende Ausrede ja in so bequemer Weise selbst gerne hin und wieder zur Anwendung bringt.“ Und das erinnert mich ganz stark an viele Beiträge zum Thema Legasthenie im Internet oder in der Literatur. Aber nur 50 % unserer Intelligenz, so der Autor auf Seite 42, sind genetisch bedingt. Seite 76: „Der Mensch ist stets ein Produkt der Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt.“ Eine Passage (Seite 90) hat mir ebenfalls sehr gut gefallen, ich kann da nur voll zustimmen: „Wir haben uns bereits darauf geeinigt, dass „Üben, üben, üben“ unverzichtbar für die Umsetzung von besonderen individuellen Leistungsvoraussetzungen in Erfolg ist. Einerseits müssen dafür individuelle Leistungsvoraussetzungen erst einmal entdeckt werden. Und andererseits ist nun auch klar, dass negativer Stress, ausgelöst etwa durch den Druck überehrgeiziger Eltern oder Trainer, theoretisch auch zu epigenetischer „Falschverwendung“ des vorhandenen genetischen Repertoires führen kann. (Anmerkung: Alle unsere Zellen besitzen alle Gene. Bei der Epigenetik geht es um die Spezialisierung der Zellen. Anders ausgedrückt, welche Gene der einzelnen Zellen abgeschaltet sind, also nicht verwendet werden.) Viele aktuelle Forschungsergebnisse in der Epigenetik betonen doch eigentlich, dass die Umsetzung besonderer Leistungsvoraussetzungen in Erfolg nicht extrinsisch erzwungen werden kann. Es muss das intrinsische Interesse von Kindern, ihre Talente in Erfolg umzusetzen, in einem psychisch positiv belegten Umfeld unter für das Kind erfreulichen Bedingungen (Spaß an der Umsetzung, Neugier wecken, Schmerzfreiheit etc.) entfacht werden.“ Genau so ist unser Lesemotivationstraining! Auch ein Grund, weshalb mir das Buch so gut gefällt. Es macht auch Mut, weiter Lesen zu lehren.
Noch drei besonders schöne Zitate:
Auf Seite 29 wird Josef Reichholf zitiert: „Wer immer nur das Gleiche lernt und auf althergebrachte Weise denkt, wird nicht weiterkommen – persönlich nicht, aber auch nicht im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften.“
Seite 63: „Wer sich traut, eine neue individuelle Perspektive zuzulassen, ja einzuladen, Kritik zu üben, erhält die unverzichtbare Chance auf neue Kombinationen und Ansätze.“ Das sollten sich viele Mächtige zu Herzen nehmen. Das würde uns aus mancher sogenannten Alternativlosigkeit herausführen.
Auf Seite 167 wird Prof. Anton Zeilinger zitiert: „Die bestbezahlte Berufsgruppe eines Landes sollten seine Pädagogen sein.“ Ja, in die Zukunftsfähigkeit der Jugend, die auch unsere Zukunft mitbestimmt bzw. gestaltet, müsste der Staat – müssen wir – mehr investieren. Ich investiere Zeit in dieses Thema mit meinem Projekt „Der Lesekoch“.
Markus Hengstschläger ist Universitätsprofessor für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien.
Hesse, Kerstin - Tandem-Lesen
Hesse, Kerstin – Tandem-Lesen
Kerstin Hesse – Tandem-Lesen: Aktivierung der Potentiale heterogener Lerngruppen – Verlag Dr. Müller – 2008 – ISBN 978-3-639-06703-3 – 49,00 Euro
Der Titel hat mich neugierig gemacht, weil ich mir für mein Projekt „Schüler trainieren Schüler“ nützliche Informationen versprochen habe. Bei der Bestellung hatte ich nicht auf den Preis geachtet. Als ich dann bei der Lieferung des kleinen Bändchens von rund 40 Seiten den Preis von 49,00 Euro hinnehmen musste, war ich doch etwas verärgert.
Die Einleitung ist getränkt mit Zitaten aus der Wissenschaft, die teilweise auf Praktiker wie mich einfach trivial und schon fast lächerlich wirken. Beispiel: „Denn wenn man wie Füssenich Schriftsprache als eine ´besondere sprachliche Funktion´, deren Erwerb einen Teil der sprachlichen und kognitiven Entwicklung darstellt´ versteht, so entsteht die Annahme, dass das Lesen für diese Sch. (Anm.: Schüler mit Förderbedarf) eine besondere Herausforderung darstellt.“
Man wird informiert, dass Lesen gleich Verstehen ist. Das finde ich auch richtig. Dass „sinnentnehmendes Lesen daher streng genommen eine Tautologie“ sei, das werde ich in meinen Elternabenden zitieren. Die Autorin: „Damit ist Lesen … keineswegs nur ein technisches Aneinanderreihen von Graphem-Phonem-Korrespondenz.“
Immer wenn es um die Praxis geht, finde ich das Büchlein dann doch ganz informativ und verständlich. Es ist z.B. gut zu wissen, dass man schon 2008 erkannt hat, dass Kinder mit schlechten Lernvoraussetzungen weniger von offenen und indirekten Lernarrangements haben. „Sie lernen besser in klar strukturierten und kleinschrittigen geleiteten Unterrichtsformen.“ So berichtet die Autorin beispielsweise aus einer Studie, die besagt, dass Lautleseverfahren mit Anleitung und Feedback sehr viel mehr Fortschritte bewirken als offene Fördermaßnahmen, wie beispielsweise freie Lesestunden.
Dass ein direkter Zusammenhang von Leseflüssigkeit und Textverstehen besteht, ist sicher richtig. Aber ich stelle bei meinen Schülern fest, dass sie den Text auch dann verstehen, wenn sie extrem langsam lesen. Die Sinnentnahme geht verloren, wenn sie zu schnell lesen.
Beim Lautleseverfahren werden zwei Formen, die auch kombiniert werden können, unterschieden:
Repeated Reading – der zu fördernde Schüler liest den Satz so lange, bis er ihn flüssig lesen kann.
Assisted Reading – Tutor und Schüler lesen gemeinsam (Choral Reading, Paired Reading) oder der Tutor liest vor und der Schüler wiederholt.
Ich zitiere eine Passage auf Seite 9: „Wenn Lernen einen aktiven Aneignungsprozess voraussetzt, kann ein erfolgreicher Leseunterricht nur gelingen, wenn Kinder zu dieser Form von Aktivität motiviert sind. Es ist also wichtig, eine Lernform zu finden, bei der sie die Tätigkeit selbst steuern und eigene Ziele bestimmen können. Ihnen muss die Funktion und der Nutzen von Schriftsprache für ihre persönlichen Interessen bewusst werden, damit sie sich in und auch außerhalb der für den Leseunterricht vorgesehenen Unterrichtszeit der Schrift zuwenden.“ Na ja, so etwas hört man heute immer wieder. Nach meiner Erfahrung ist nur der erste Satz richtig. Die Motivation muss nicht unbedingt derart rational, wie oben beschrieben, begründet sein. Oft reicht schon die Erkenntnis, dass man einen Partner hat, der einen versteht und einem hilft. Und das ist beim Tandem-Lesen oder meinem Projekt „Schüler trainieren Schüler“ allermeist der Fall.
Die Projektdokumentation finde ich gelungen, und ich greife ein paar Punkte daraus auf.
Beim Tandem-Lesen wird zwischen Tutor und Schüler ein Stopp-Zeichen vereinbart, dass immer dann gebraucht wird, wenn sich der Schüler verliest.
Korrigiert sich der Schüler von selbst, ist das ein gutes Zeichen. Das ist auch meine praktische Erfahrung.
Interessant ist, dass die Schüler das Lesen mit einem Diktiergerät aufnehmen und dann abhören. Ich nehme zwar meine Schüler beim Ersttraining auf, um daraus meine ersten Fördermaßnahmen abzuleiten, aber ich werde demnächst meinen Schülern – mit größtmöglicher Feinfühligkeit – ihre Leseleistung per Diktiergerät vorführen. Im Vergleich zur Aufnahme beim Ersttraining könnte das sogar ermutigend wirken.
Die Autorin betont die Wichtigkeit des räumlichen Abstands der Lese-Tandems. Bei meinen Projekten sitzen die Tandems meist sehr eng beieinander. Das war bisher nur in Ausnahmefällen ein Problem.
Die Autorin berichtet, dass es für einige Schüler problematisch war, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der sich im Leistungsniveau unterscheidet. Bei meinem Training, bei dem Acht- oder Neuntklässler mit Fünftklässlern lesen, ist das kein Problem.
Beim Projekt der Autorin wird auch mit Antolin am Computer gearbeitet. Sie berichtet, dass die Motivation, am Computer zu arbeiten, sehr groß ist. Ich kann das nur bestätigen.
Bei Wörtern, die beide nicht kennen, wird der Einsatz von Wörterbüchern empfohlen. Das werde ich bei meinem Projekt auch einführen.
Nach Abschluss der Lektüre war ich dann doch versöhnlicher gestimmt, denn ich konnte die Ausführungen mit meinem Projekt „Schüler trainieren Schüler“ abgleichen. Wer sich für Tandem-Lesen interessiert und wen die 49 Euro nicht schmerzen, ist gut bedient. Der Projektbericht ist hilfreich.
Kaube, Jürgen - Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?
Kaube, Jürgen – Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? – ROWOHLT – Berlin, 2019
Die spannende Einleitung beginnt mit Naina, die Gedichtanalysen in vier Sprachen schreiben kann, aber in der Schule nichts über Steuern, Miete und Versicherungen gelernt hat. Es geht dann um Pisa, um die Folgen, dass es immer mehr um Kompetenzen und weniger um Können und Wissen geht, um die Einzugsgebiete der Schulen und wie sich die auf die Schulerfolge auswirken, um Reformen wie „Schreiben nach Gehör“ und um die Reformpädagogik. Mir gefällt besonders der Satz: „Unterricht soll es den Schülern nicht leichtmachen. Denn er dient der Übung, Schwierigkeiten zu überwinden.“ Das erste Kapitel macht neugierig. Noch ein Zitat: „Und entscheidend ist auch nicht, dass Stunden ausfallen, sondern was geschieht, wenn sie stattfinden.“
Im 2. Kapitel stellt der Autor dar, dass die Schule vergeblich versucht, unsere gesellschaftliche Zukunft zu sichern. Er beschäftigt sich mit Bildung und dem wirtschaftlichen Erfolg der Gebildeten. Mehr Bildung, dafür gibt es Konsens. Bildungspolitisch kontrovers aber wird es, wenn gefragt wird, wie die Schulen ihre Aufgaben erfüllen sollen. In der Schule lernt man nicht fürs Leben, sondern für die Schule, was sich dann aber im Leben auszahlt. Es wird viel vergessen, und zwar in allen Fächern, wenn es nicht ständig wiederverwendet wird. Der Autor fragt: „Was aber honoriert der Arbeitsmarkt dann an erworbenen Bildungsabschlüssen, wenn sie nur verblasste Kenntnisse dokumentieren, von denen drei Viertel nicht einmal für die jeweiligen Stellen nützlich wären? Die Antwort ist, dass er die Intelligenz und den Fleiß derjenigen honoriert, die sich in der Lage zeigten, all die Prüfungen zu bestehen, die für den jeweiligen Abschluss erforderlich waren.“ Ganz wichtig ist auch der gut erläuterte Hinweis, dass sozialer Aufstieg davon abhängt, ob es geeignete Stellen gibt und „nicht von einem inneren Kapital der Absolventen.“
Kapitel 3 kreist um die Aussage: „Die Bildungspolitik kann die Grundschulen stärken und in Vorschulerziehung investieren, um krasse Ungleichheiten aufgrund unterschiedlicher Familienhintergründe zu dämpfen. Sie kann sich aber nicht als die eigentliche Sozialpolitik darstellen und behaupten, die Schule eigne sich dafür, der Ort des Ausgleichs jedweder gesellschaftlicher Asymmetrien zu sein.“ Deswegen ist das Kapitel auch überschrieben: „Was von der Schule vergeblich verlangt wird: sozialer Aufstieg für alle“. Der Autor beschreibt auch die Zwickmühle, in der sich die Lehrer befinden. Sie sollen nämlich so unterrichten, dass alle die gleichen Chancen haben. Sie sollen Nachteile ausgleichen. Aber die Lehrer sollen andererseits jedem einzelnen Kind gerecht werden, also die Individuen fördern. Und die Schule kann auch nicht das soziale Umfeld, in das die Schüler eingebunden sind, ausblenden.
Kapitel 4 – Was die Schule kann: Denken lehren. Ein Lesevergnügen! Ich fasse mit einem Zitat zusammen: „Das Denken folgt dem Wissen, das Können dem Geübthaben. Lernen ist Arbeit, Umgang mit widerständigen Materialien.“
Kapitel 5 ist mein Lieblingskapitel: „Was die Schule muss: Lesen, Schreiben, Rechnen unterrichten.“ Was ich immer mit „auf Sand bauen“ bezeichne, wenn die Grundlagen nicht beherrscht werden, formuliert der Autor so: „Man muss das zweite Stockwerk nicht verschönern, wenn es keine Treppe gibt, und man braucht keinen Treppenausbau, wenn das Haus gar nicht betreten werden kann.“ So wird bei uns rund ein Fünftel der Grundschüler, die nicht richtig lesen können, in den weiterführenden Schulen mit neuen Fächern konfrontiert, in denen sie ohne diese Fähigkeit nicht auskommen können. Der Autor betont die Notwendigkeit, die Grundschulen besser auszustatten. Denn der Aufwand, etwas wiedergutzumachen, was anfänglich versäumt wurde, ist erheblich. Das Zitat von Lehrern weiterführender Schulen kann ich aus der Praxis bestätigen: „Gebt es (das Geld für Bildung) früh aus. Schickt uns Kinder, die lesen können.“ Der Autor weist auch nach, dass es unsinnig ist, schon in der Grundschule Englisch zu lehren. Die Zeit fehlt für Deutschstunden, was man auch in Blogbeiträgen von mir lesen kann. Der Autor fragt, warum man von der bewährten Methode des Abschreibens von der Tafel wegging. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen der sogenannten „kind-zentrierten Pädagogik“ insbesondere am Beispiel „Schreiben nach Gehör“. Er stellt klar, dass der Reformvorschlag nicht von einem Missstand bei den Rechtschreibleistungen ausging, „sondern von einer gefühlten Differenz zwischen wirklichem Unterricht und vorgestelltem Unterrichtsideal.“ Er sagt, dass das Ziel des frühen Deutschunterrichts nicht sein kann, kreativ zu schreiben, sondern eine Technik zu erwerben, die der Verständigung und dem lesenden Zugang zur Welt dient. Das entspricht genau der Erfahrung, die ich in jetzt fast zehnjähriger ehrenamtlicher Praxis in Grund- und Mittelschulen gemacht habe. Als Lesetrainer gefallen mir besonders die Ausführungen zu den Lesestrategien, die ich in der Praxis bisher auch noch nie verstanden habe. Ich lese jeden Text mit der gleichen Strategie. Ich dachte mir schon immer, dass man solche Strategien nur brauche, wenn man nicht sehr gut lesen könne. Ein abschließendes Zitat aus diesem Kapitel: „Die Schule (hier die Grundschule) hat vielerorts den Sinn für Wiederholung, Übung, Einübung verloren. Wo immer jemand sie verlangt, regt sich der Protest, das sei nicht kreativ, sondern autoritär und ´old style´, das sei nicht individuell, nicht kindgerecht, nicht selbstwirksam und irgendwie schön.“
Zum Kapitel 6 – Der Sinn von Prüfungen – nur ein Zitat: Die Probleme sind … nicht in erster Linie die Noten und ihre Diagnosedefizite. Das Problem sind gedankenlose Prüfungen und Prüfungen, aus denen nichts folgt, außer der Note.
Im Kapitel 7 – Die Freiheiten des Unterrichts – wird u.a. die Frage aufgeworfen, warum in jeder Fremdsprache Vokale gelernt werden, nur nicht im Deutschen, weil man meint, die Wörter wären eine Selbstverständlichkeit. Aber in Diktaten erweist sich dann das als nicht gegeben. Aber, so der Autor, das nicht Selbstverständliche wird nicht geübt, sondern das Diktat wird abgeschafft. Der Autor setzt sich auch noch einmal mit dem schülerzentrierten Unterricht auseinander. Es komme vielmehr darauf an, Schwierigkeiten interessant zu machen und zu lehren, dass man bei den Sachen verweilen muss, damit sie einem etwas sagen.
Im Kapitel 8 geht es um die Befreiung von Digitalisierungsfantasien. Hier fragt der Autor u.a., ob sich ein intelligenter Umgang mit dem Internet überhaupt vom intelligenten Umgang mit irgendetwas anderem unterscheidet. Zitat: „Der Begriff ´Medienkompetenz´ suggeriert, dass Schüler selbst entscheiden können, was aus dem Chaos der Googeltreffer wert ist, weiterverarbeitet zu werden. Aber das gelingt den wenigsten, und die, die es schaffen, schaffen es nicht aufgrund von Medienkompetenz, sondern weil sie in der Sache Bescheid wissen, weil sie nachgedacht haben, Phrasen erkennen können, über gesunden Menschenverstand verfügen.“ Der Autor stellt fest: „Überraschenderweise finden sich auch ohne entsprechenden Schulunterricht und ohne digitalisierte Schule die meisten Berufstätigen unschwer mit diesen Geräten zurecht.“ Interessant ist die Beschreibung des Buchs „Coden mit dem Calliope mini“ aus dem Cornelsen Verlag.
In den Kapiteln 9 und 10 geht es darum, wovon man die Schule befreien muss: von Lehrerillusionen und vom Zentralismus. Dazu gehört z.B., dass die Lehrkraft ihren Unterricht an fünfundzwanzig unterschiedliche Lernstände und Unterstützungsbedürfnisse anpassen soll, und zwar kontinuierlich, bei gutem Lernklima und unter Erreichen bestimmter unabdingbarer Lernziele. Es geht auch um den Frontalunterricht, der abgelöst werden soll, weil die Schüler selbst herausfinden sollen, was interessant ist und wann sie welchen Lernfortschritt verwirklichen. Sehr instruktiv ist die Darstellung des Beispiels eines Lehrplans.
Kapitel 11 – Schüler sind Kinder, Kinder sind Schüler – Die meisten Unterschiede zwischen Schülern gehen darauf zurück, dass die Schüler schon sozialisiert und auf bestimmte Weise erzogen sind, wenn sie in der Schule ankommen. „Vor allem der Sprachgebrauch der Eltern führt zu erheblichen Unterschieden.“ Beschrieben werden die gesellschaftlichen Veränderungen, die auf die Schule einwirken. Die Schule kann auch nicht „etwas wegerziehen, was Erwachsene täglich als normal vorführen“.
In den Kapiteln 12, 13 und 14. geht es darum, was zu tun ist: Lehrerbildung, Wettbewerb, Erziehung. Die drei Kapitel runden das Buch ab und zeigen, was geändert werden müsste. Als Praktiker habe ich auch diese drei Kapitel gerne gelesen, Selbsterkanntes bestätigt und Anregungen bekommen.
Klicpera/Schabmann, Gasteiger-Klicpera, Legasthenie - LRS
Klicpera/Schabmann/Gasteiger-Klicpera – Legasthenie – LRS – 4. Auflage, 2013 – Reinhardt UTB
Das Buch war ein Zufallsfund beim Stöbern in einer Buchhandlung. Da ich die Namen Klicpera und Gasteiger-Klicpera schon oft in Zitaten gelesen habe, war ich interessiert. Eine Passage im Vorwort hat mich dann zum Kauf bewogen: „In der pädagogischen Diskussion sowie in der Deutschdidaktik wird vorwiegend der Begriff Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten benutzt und als sinnvoll erachtet, weil damit akzentuiert wird, dass es sich dabei nicht um eine Störung handelt, sondern um eine Schwierigkeit, die durch adäquate Förderung und Unterstützung der Kinder behoben werden kann. … Allerdings ist uns auch bewusst, dass weder in der Ausbildung der Lehrer noch in der Organisation der Rahmenbedingungen des Unterrichts die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass diese Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens auch tatsächlich im Unterricht möglich ist.“
Es wird im Vorwort weiter zum Ausdruck gebracht, dass es bei der Förderung keiner Unterscheidung zwischen LRS und Legasthenie, die aus dem medizinischen Bereich kommt, bedarf.
Das Buch richtet sich an Lehramt-, Pädagogik- und Psychologiestudenten, will aber auch Lehrern einen Überblick über die Prozesse des Lesens und Schreibens verschaffen. Es ist auch für mich als Praktiker interessant, wenngleich auch manchmal anstrengend, das Werk zu lesen. Das trifft zum Beispiel auf die Kapitel 1 und 2 zu, in denen es um die Entwicklung des Lesens geht. Da ich mich in meiner Förderpraxis in erster Linie für die Verbesserung der Lesefertigkeit bzw. -kompetenz einsetze, gehe ich auf die Ausführungen zum Rechtschreiben hier nicht ein.
Im Kapitel über das Leseverständnis (Kapitel 3) wird u.a. ausgeführt, dass die basale Lesefertigkeit nicht die einzige Einflussgröße des gesamten Prozesses ist. Amüsant finde ich Formulierungen wie z.B.: „Der Einsatz dieser Fertigkeiten (Anm.: Es geht um die differenziert vorher aufgeführten Komponenten des Leseverständnisses) setzt allerdings voraus, dass der Leser auch immer ein „strategischer“ Leser ist, der es versteht, seine kognitiven Ressourcen aufmerksam zu orchestrieren.“
Im Kapitel 4 wird die Geschichte des Lese- und Schreibunterrichts mit den verschiedenen Vorgehensweisen anschaulich erläutert. Ich kannte als Quereinsteiger nur Teile davon. Zitiert wird eine Untersuchung von Schründer-Lenzen, die zu dem Ergebnis kommt, dass im Anfangsunterricht eine systematische Instruktion besonders wichtig sei, da insbesondere leistungsschwache Schüler auf einen gut strukturierten und systematischen Unterricht angewiesen sind. Ich finde, dass diese Erkenntnis vielen modernen Pädagogen nicht bewusst ist. Ein Satz ist ganz besonders zu unterstreichen: „Der entscheidende Faktor für den Lernerfolg der Kinder ist daher nicht so sehr die Methode, sondern die Unterrichtsqualität.“ Der Lehrer spielt also die wichtigste Rolle!
Und mit folgender Passage fühle ich mich (mit meinem Übungssystem) richtig wohl: „Andere Kinder jedoch – und das trifft vor allem für die schwächeren zu – benötigen weiterhin explizite Instruktion der Buchstaben-Laut-Korrespondenzen, mehr Übungszeit für das Lesen und genügend einfache Texte und Materialien, um den Zusammenhang zwischen Buchstaben und Lauten einzeln zu vertiefen, kleinere Einheiten zu wiederholen und viel Übung, eventuell auch die Teilung längerer Worte in Silben, um das Gedächtnis zu entlasten und die Worte untergliedern zu können.“
Im Zusammenhang mit dem phonologischen Bewusstsein steht auf Seite 102: „Wenn nicht von Anfang an eine klarere Bewusstheit über die zu meisternde Aufgabe besteht, versäumen die Kinder wesentliche Schritte.“ Wie wahr, aber wie oft wird das in der Praxis nicht beachtet!
Auch folgende sehr zu begrüßende Feststellung (Seite 103) stellt sich in der Praxis aber leider oft nicht ein: „Die zweite Klasse wird dabei vielfach als eine Art Übergangsklasse betrachtet – als letzte Chance für die Kinder, das bisher noch nicht sicher Beherrschte aufzuholen, bevor dann das Lesen nicht mehr als Lerngegenstand, sondern als Instrument zum Lernen im Vordergrund steht (Snow et al. 1998).“ In Mittelschulen haben 20 bis 30 Prozent der Schüler Leseschwierigkeiten.
Für Trainer wichtig ist folgender Satz auf Seite 104, den ich aus meiner Praxis nur bestätigen kann: „Ein kritischer Bestandteil solcher Übungen (Anm.: lautes Lesen bzw. Mitlesen) ist dabei die Fehlerkorrektur. Diese soll nicht zu schnell erfolgen, damit der Schüler selbst noch eine Möglichkeit hat, seinen Fehler zu korrigieren. Auch ist ein bloßes Verbessern durch Aussprechen des richtigen Wortes durch den Lehrer nicht günstig. Besser ist es, die Schüler selbst korrigieren zu lassen und ihnen dabei Hinweise bzw. Hilfen zu geben (Reitsma 1988).
Beschrieben werden im 4. Kapitel auch weitere Techniken der Leseförderung, z.B. das wiederholte Lesen, das Echolesen (Lehrer liest vor, Schüler wiederholt) usw.
Neu war für mich der Begriff „invented spelling“ oder auch „selbst erfundene Rechtschreibung“ (Seite 105 f). Ich kenne das unter den Begriffen „freies Schreiben“ oder „lautgetreues Schreiben“. Als Argument dafür wird angeführt, dass es zu einer größeren Sensibilität für die Lautstruktur der Sprache führt. Das haben mir auch schon Lehrer gesagt, die diese Methode verteidigen. Im Buch werden dazu Untersuchungen zitiert. Ein Vorteil der Methode ist, dass die Kinder schon sehr bald Geschichten schreiben können. Ich halte die Methode aber nicht für zielführend im Sinne der Rechtschreibung.
Gut gefallen hat mir die Passage auf Seiten 108/109, die sich fast wie eine Reminiszenz an gute alte Lernzeiten erinnert: „Weiterhin muss man berücksichtigen, dass noch am Ende der ersten Klasse Kinder recht viele Wiederholungen (wenigstens etwa zehn Wiederholungen) beim Lesen brauchen, damit sie sich die Schreibweise eines Wortes merken können.“
Besonders interessant ist das Kapitel 4.6 zur Unterrichtsorganisation. Dort wird auch der Einsatz von Tutoren beschrieben. Als mögliche Tutoren werden genannt: Schüler höherer Klassen, Studenten, Mitglieder der lokalen Gemeinde. Die Tutoren sollen eine Einführung bekommen. Es soll eine detaillierte Anleitung verfasst werden. Zusätzlich sollten die Tutoren von einem Lehrer oder anderen Spezialisten aus der Schule begleitet und supervidiert werden. Schade nur, dass in den Schulen kaum Zeit vorhanden ist, eine solche Unterstützung zu geben. Die Schulämter wären hier gefordert. Mein Traum ist, dass diese Unterstützungsmöglichkeiten ganz offiziell in den Lehrplan mit aufgenommen werden. Warum können die Schulbehörden nicht zugeben, dass die Schulen Hilfe brauchen, und diese Hilfe entsprechend fördern?
Im Kapitel 5 geht es dann um die Eltern. Vieles, was da an Fördermöglichkeiten besteht, sind natürliche Verhaltensweisen in intakten Familien. Aber die Wichtigkeit der beschriebenen Maßnahmen ist nur zu unterstreichen. Das Kapitel ist für Trainer sehr hilfreich. Besonders gefallen hat mir die Passage (Seite 123), wo eine Partnerschaft zwischen Schule und Eltern gefordert wird. Beklagt wird, dass die Eltern nur selten Hilfestellung für die Begleitung der Hausübungen erhalten. Demnach trifft mein Lese-Hörbuch also genau ins Schwarze. Ich überlege mir, ob ich eine schriftliche Vereinbarung bezüglich der Förderung einzelner Schüler mit den Eltern und evtl. sogar den Lehrern treffen sollte.
Kapitel 6 behandelt sehr ausführlich die Definition, Häufigkeit und Prognose von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.
Spannend ist Kapitel 7: Entwicklung des Lesens und Schreibens bei schwachen Schülern. Ich finde dort auch ein Beispiel für meinen größten Problemfall: „Nicht zu vernachlässigen sind auch die Probleme beim Behalten bereits gelesener Wörter, von denen sie (Anm.: die Kinder) selbst nach drei Monaten, wenn die Zahl der Wörter noch recht klein ist, einen größeren Teil nicht erinnern und lesen können.“ Bei einem meiner Schüler ist es so, dass innerhalb einer Lerneinheit ein gelerntes Wort auf der nächsten Seite schon nicht mehr präsent ist, allerdings nicht generell, sondern partiell.
In einem Punkt sind meine Erfahrungen anders als im Buch beschrieben, und das betrifft die Pseudowörter. Meine Schüler machen beim Lesen von Pseudowörtern deutlich weniger Fehler als sonst. Es sind Schüler, die sich beim Lesen eine Ratetechnik angeeignet haben. Wenn diese Schüler wissen, dass sie nicht raten können, weil es eben Pseudowörter sind, dann lesen sie diese meist richtig, wenngleich machmal auch recht langsam. Mich wundert, dass in diesem Buch die Ratetechnik überhaupt nicht vorkommt. Sie ist aber die Ursache für viele Leseschwierigkeiten.
Im Kapitel 8 geht es um die Unterscheidung von Kindern mit verschiedenen Formen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Ich finde die Ausführungen sehr interessant, allerdings vermisse ich auch hier Informationen zur Ratetechnik.
Im Kapitel 9.1 geht es dann um die Ursachen der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Zum Inhalt kann ich nur ein Ausrufezeichen setzen. Die Ausführungen zur Vererbung und zu den Genen habe ich nur überflogen. Schließlich ändert sich da ständig etwas, und für mich ist nach wie vor offen, was die Kenntnis der Details bringt. Frühförderung nur bei Kindern, bei denen genetisch bedingte Leseschwierigkeiten wahrscheinlich sind, erscheinen mir aus vielen Gründen fragwürdig. Es sollte generell eine Frühförderung zum phonologischen Bewusstsein stattfinden. Wie schon erwähnt, vermisse ich in diesem Buch Ausführungen zur Ratetechnik.
Kapitel 9.2 und 9.3 sowie 10 verstehe ich als guten Überblick über mangelnde kognitive Fähigkeiten und soziale Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sowie den Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten.
Kapitel 11 behandelt die Diagnostik.
Das letzte Kapitel 12 behandelt die Intervention und Therapie bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Es geht natürlich auch um Frühförderung. Es heißt auf Seite 252: „Leseschwierigkeiten haben von Beginn an die Tendenz, sich zu verfestigen. Je länger sie andauern, desto schwieriger wird eine Intervention, da die Diskrepanz zwischen Kindern mit Leseschwierigkeiten und normalen bzw. guten Lesern immer größer wird. Daher sind Interventionen umso vielversprechender, je früher sie einsetzen.“ Dieser Satz gehört fett gedruckt und eingerahmt! Ich fand das Kapitel sehr hilfreich. Auch der Einsatz von Computern zur Leseförderung wird beschrieben. Gefordert wird auch die Einbeziehung der Eltern in den Förderprozess. Diese Ausführungen sollten alle Eltern lesen. Ich sage Ähnliches in meinen Elternabenden zur häuslichen Leseförderung. Seite 286: „Da diese Kinder das Lesen und Schreiben als sehr anstrengend und schwierig erleben, besteht die Gefahr, dass die Eltern zusätzlich Druck auf die Kinder ausüben, so dass diese die Freude am Lesen gänzlich verlieren.“
Eine kontinuierliche Beratung und Betreuung der Eltern ist daher notwendig. Ich kann das nur unterstreichen. Lesen hat man noch nie nur in der Schule gelernt. Heute meinen aber viele Eltern, dass die Schule diese Aufgabe alleine bewältigen sollte.
Es kommt im Buch auch klar zum Ausdruck, dass Skepsis bei Fördermaßnahmen angebracht ist, die sich nicht auf das Lesen (bzw. Rechtschreiben) direkt beziehen (Kapitel 12,13.)
Mein Fazit: Ein nützliches Buch für Lesetrainer, teilweise sehr spannend und anregend, auch deswegen, weil es immer wieder Parallelen zur eigenen Trainingspraxis gibt.
Dr. Astrid Kopp-Duller, Legasthenie und LRS, Der praktische Ratgeber für Eltern
Kopp-Duller, Astrid – Legasthenie und LRS, Der praktische Ratgeber für Eltern, Herder spektrum
Ein Standardwerk. Mich haben einige Ausführungen aber nicht überzeugt, weil sie mit dem, was ich in der Praxis feststelle, nicht übereinstimmen.
Die Autorin betont z.B., dass man keine Kinder zu Legasthenikern machen kann. Man könne das manchmal von weniger informierten Eltern hören, die meinen, man könne einem Kind das Schreiben und Lesen so falsch beibringen, dass es zu einem legasthenen Menschen wird. Genau das glaube ich im Gegensatz zur Autorin aber doch. Beim Schreiben ist es für mich eindeutig, dass das freie oder ungeregelte Schreiben eine wesentliche Ursache für die zunehmenden Rechtschreibschwierigkeiten darstellt. Beim Lesen gibt es viele Ursachen. Für mich steht fest, dass viele Schüler zu bald beginnen, schnell zu lesen. Manche Kinder bräuchten einfach mehr Zeit und/oder schon sehr früh eine individuelle Förderung. Ich sage immer: Richtiges Lesen geht vor schnellem Lesen.
Die Autorin weist darauf hin, dass allen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten besondere Sinneswahrnehmungen zugrunde liegen, die von den normalen Sinneswahrnehmungen abweichen. Diese besondere Art der Sinneswahrnehmung führe dazu, dass es bei der Beschäftigung mit Symbolen, wie es die Buchstaben sind, zu Komplikationen in der Verarbeitung kommt (wie es bei legasthenen Menschen immer der Fall ist). Es heißt, dass nur einwandfrei funktionierende Sinneswahrnehmungen ein fehlerfreies Schreiben und Lesen garantieren. Abweichende Sinneswahrnehmungen würden die zeitweise (freilich nicht ständige) Unaufmerksamkeit des legasthenen Menschen bei Schreiben und Lesen bewirken. Manchmal können sich legasthene Kinder auch sehr gut auf die Tätigkeit des Schreibens und Lesens beziehen und bei der Sache bleiben. Dieser Zustand der Aufmerksamkeit könne von den Kindern nicht bewusst gesteuert werden; so ist es schließlich immer ein Zufall, wenn es gelingt. So weit die Autorin. Meine Meinung: Am Anfang meines Lesetrainings habe ich keinerlei Fachliteratur gelesen. Ich habe mich lange gefragt, warum die Schüler etwas anderes lasen, als auf dem Papier stand. Warum z.B. wurde „der“ statt „die“ gelesen oder z.B. „eine“ statt „einen“ usw.? Erst als ich im Text auf einzelne solcher Wörter deutete und diese isoliert lesen ließ, machte es bei mir Klick. Die Wörter wurden nämlich einzeln alle richtig gelesen. Aber im Text wurden sie „gebeugt“. Die Schüler haben sich auf andere Wörter konzentriert, auf für die Sinnentnahme wichtige Wörter. Der Rest wurde angepasst. Man hat nicht gelernt, die Wörter schnell und vor allem richtig zu entschlüsseln. Deshalb kann ich dem folgenden Satz auf Seite 24 auch nicht zustimmen: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass man von einer Legasthenie dann sprechen kann, wenn die Sinneswahrnehmungen vom Durchschnitt abweichen, was eine zeitweise Unaufmerksamkeit bei den Tätigkeiten des Schreibens und Lesens hervorruft. Durch diese Unaufmerksamkeit macht das Kind beim Schreiben und beim Lesen so genannte Wahrnehmungsfehler.“ Ich bin davon überzeugt, dass die Lesetechnik zumindest „meiner“ Schüler mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten falsch ist.
Aber folgender Passage kann ich nur zustimmen: „Keinesfalls ist es berechtigt, einen legasthenen Menschen als kranken oder behinderten Menschen zu bezeichnen. Legasthene Menschen können ja das Schreiben und Lesen genauso erlernen wie jeder andere Mensch auch, nur die Voraussetzungen müssen andere sein. Nur weil ein gewisser Prozentsatz der Menschen für das Erlernen dieser Fähigkeiten andere Voraussetzungen hat, sind sie doch nicht krank!“ Das heißt also, auch die Autorin glaubt, dass man die von ihr genannten Wahrnehmungsfehler vermeiden kann. Sonst würde ich es nicht verstehen.
Auch die Autorin plädiert für das Einzeltraining, das mindestens ein Jahr dauern sollte.
Ein ganz bedeutender Schritt, so schreibt die Autorin, den das legasthene Kind vollziehen muss, bestehe darin, dass es ganz bewusst erkennt, dass jedes Wort aus einer bestimmten Anzahl von Buchstaben besteht. Das passt gut zu meiner Methode, den Text buchstabenweise zu präsentieren und das Wort erst lesen zu lassen, wenn es vollständig ist. Bei entsprechender Geschwindigkeit wird sofort deutlich besser gelesen, allerdings halt sehr langsam.
Kraus, Josef – Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt
Kraus, Josef – Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt – HERBIG, Stuttgart – 2017 – ISBN 978-3-7766-2802-9
Das Vorwort ist überschrieben: „Wider eine Bildungspolitik, die keine Probleme löst, sondern Probleme schafft“. Stichworte sind: Egalisierungswahn, Pisa, Bologna, Erleichterungspädagogik u.a.
Der Autor setzt sich in drei Kapiteln mit falschen Strukturen, falschen Vorgaben und falscher Sprache auseinander, um dann zum Schluss Eltern zu raten, was sie trotz allem tun können.
Im Kapitel über die falschen Strukturen lese ich einen Satz, den ich – so ähnlich – schon öfter in Diskussionen mit Lehrern gesagt habe: „Je niedriger die Hürden in der Schule, desto schwerer fällt es den jungen Leuten, die Hürden im späteren Leben zu überwinden.“ Schöner kann man das Problem der Gefälligkeitspädagogik nicht auf den Punkt bringen. Sehr treffend finde ich auch die „Kampfvokabel Frontalunterricht“. Denn, so wie der Autor schreibt, profitieren gerade die leistungsschwächeren und jüngeren Kinder von einem klar strukturierten Unterricht. Was die Schulnoten anbetrifft, so gefällt mir folgender Satz sehr gut: „Bei etwas mehr Gelassenheit hätten die Kinder auch weniger Nöte mit ihren Erziehern, denn mit den Noten gehen sie ohnehin viel unbefangener um als ihre ´Alten´“. Wunderbar finde ich die Abrechnung mit „Apokalyptikern und Wichtigtuern mit medialem Promi-Faktor“. Jedes Mal, wenn ich etwas von Richard David Precht oder Gerald Hüther lese oder sehe, geht mir Ähnliches durch den Kopf. Die Aussage von Gerald Hüther, dass jedes Kind hochbegabt sei, kontert der Autor mit der Bemerkung: „Wenn jedes Kind hochbegabt ist, dann ist kein Kind hochbegabt.“ Auch mit der Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich der Autor ausführlich. Das Thema Kompetenzen ist überschrieben: „Lehrpläne oder Leerpläne“! Ich habe da in meinen Blogbeiträgen auch schon von Kompetenzeritis gesprochen. Zum Schluss wird die Kompetenzpädagogik als eines der „gefährlichsten Trojanischen Pferde deutscher Schulpolitik und Schulpädagogik“ bezeichnet.
Im Kapitel über falsche Vorgaben geht es zuerst um „online oder offline“. Auf Seite 105 heißt es dazu: „Schlicht und einfach: Es bringt nichts!“ Der Autor stellt vielmehr die „Medienmündigkeit“ in den Fokus. Weitere Themen sind das Gymnasium und die Ganztagsschule und – ganz besonders lesenswert – die Inklusion. Was der Autor über die Einmaligkeit des deutschen Förderschulwesens lobend schreibt, kann ich inzwischen durch meinen Einsatz an solchen Schulen nur bestätigen.
Ganz besonders gerne habe ich das Kapitel über „falsche Sprache“ gelesen. Sätze wie „Wer die Sprache beherrscht, durchschaut leichter den Missbrauch von Sprache in Reklame und Propaganda“, gehen runter wie Öl. Oder: „Sprache ist das wichtigste und das einzige humane Instrument der Konfliktlösung. Wo Sprache versagt, da regiert die Faust – im zwischenmenschlichen und im politischen Bereich.“ Und mit Denglisch und der Gender-Sprache geht der Autor – meiner Meinung nach zu Recht – hart ins Gericht. Der Autor setzt sich auch sehr kritisch mit der Entwicklung der Rechtschreibung auseinander, insbesondere mit den Irrungen und Wirrungen der Rechtschreibreform. U.a. wird die „Beliebigkeit von Schreibungen (Variantenschreibungen)“ angeprangert. Was zu tun ist, sagt der Autor in aller Deutlichkeit: „Es gäbe eine besonders wirksame Möglichkeit, die Rechtschreibung der jungen Leute zu verbessern: sie in den Schulen konsequenter zu üben und zu bewerten, anstatt sie zu diskreditieren …“ Dazu noch die Feststellung: „Kaum eine andere Kulturnation der Welt stattet ihre Sprache schulisch mit so wenig Stunden aus wie die deutsche.“ Schließlich geht es dem Autor dann auch noch um die Verkennung der Bedeutung der Handschrift.
Im letzten Kapitel gibt es Ratschläge für Eltern. Die werden dort nicht immer auf fruchtbaren Boden fallen, wie ich aus Erfahrung weiß. Zum Beispiel: „Seien Sie Ihren Kindern in puncto Neugier und Lesen ein Vorbild!“ Schön gesagt, aber vielleicht hilft ja der Hinweis auf eine Studie, aus der Folgendes hervorgeht: „Wer Bücher liest, verdient später 21 Prozent mehr.“ Noch ein Rat, der mir gut gefällt: „Der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur!“ Schließlich habe ich auch keines.
Kruse/Reichardt (Hg.) - Wie viel Rechtschreibung brauchen Grundschulkinder?
Norbert Kruse/Anke Reichardt, Herausgeber – Wie viel Rechtschreibung brauchen Grundschulkinder? Positionen und Perspektiven zum Rechtschreibunterricht in der Grundschule – Erich Schmidt Verlag – 2016 – ISBN 978 3 503 16537 7
Praktiker wie ich gehören bestimmt nicht zur Zielgruppe dieses Bandes, in dem sich „acht Beiträger und Beiträgerinnen“ (sic) in drei Schreibrunden mit dem Thema befassen. Für Praktiker ist es eine schwere Kost. Ich musste manchmal im Fremdwörterbuch nachschlagen, und oft erschien es mir, als wollten die Autoren sich gegenseitig mit Fachchinesisch und komplizierten Formulierungen übertrumpfen. Beispiel (Seite 172, Birgit Mesch: „Es geht um die qualitative Beschreibung und theoretische Modellierung von Schrift, der die quantitativ-statistische nachgeordnet ist – zumal, wenn das Modell die Grundlage und den Referenzrahmen für die Modellierung orthografischer Kompetenzen liefern soll. Es geht darum, schriftsprachliche Einheiten – gleich welcher Ebene – in paradigmatische und syntagmatische Relation zueinander sowie in Relation zu Einheiten höher und tiefer liegender Ebenen zu setzen.“ Selbige Autorin trumpft auf Seite 110 mit dem Satz auf: „Er (der systematische Zugang zur Schriftsprache) zielt darauf ab, sie (die Kinder) in einem Minimum an Zeit ein Maximum an sprachlichen Strukturen entdecken zu lassen.“ Da verlieren die verkopften wissenschaftlichen Formulierungen Ihren Glanz, und ich denke mir, dass da ein gerüttelt Maß an geistiger Schaumschlägerei dabei ist. Minimax geht nicht. Betriebswirte lernen das im Studium. Und auch bei der folgenden Stelle reibe ich mir als Betriebswirtschaftler verwundert die Augen (Beate Leßmann, Seite 31): „Jedes einzelne Kind benötigt so viel Rechtschreibung, wie es bewältigen kann.“ Tolle Zielsetzung, denke ich mir da.
Aufmerksam auf das Buch geworden bin ich durch eine Diskussion im Forum Legasthenie und Dyskalkulie bei Facebook. Ein Hinweis auf den Beitrag von Carl Ludwig Naumann hat mich neugierig gemacht. Es ging um die Frage, ob Silben für die Rechtschreibung förderlich oder schädlich sind. Und tatsächlich, dazu bietet der Band viele Informationen. Silbe oder Morphem, das ist die Frage. Die Wissenschaftler sind sich nicht einig. Und das verwundert mich immer, wenn es heißt, dass bei einem bestimmten Konzept die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt sind. Oft sind das die Fehler von morgen. Manche Autoren schwören auf die Silben, andere auf Morpheme, andere halten Mischsysteme für sinnvoll, was meiner in der Praxis gereiften Auffassung entspricht. Beim Lesenlernen ist, wegen des Leseflusses, die Silbe wichtig. Bei der Rechtschreibung braucht man auch den Wortstamm. Und da empfehle ich z.B. die lehrreichen Schriften von Dorothea und Günther Thomé sowie die von Sabine Omarow.
Der erwähnte Carl Ludwig Naumann schreibt auf Seite 69: „Ein Verfügen über die basalen Beziehungen zwischen Phonemen und Graphemen schafft eine hohe Sicherheit für richtiges Schreiben, nämlich 90 Prozent.“ Das könnte ein Satz aus der Werbung sein. Die Aussage stimmt und ist zugleich falsch. Wenn ein Schüler in einem Diktat mit 100 Wörtern alle basalen Phonem-Graphem-Beziehungen richtig schreibt und alle anderen falsch, dann hat er nicht 90 Prozent der Wörter richtig, sondern eine sehr kleine, denn die Anzahl an Wörtern, die lautgetreu geschrieben werden, ist relativ klein.
Generell wird die Anlauttabelle als unverzichtbar hingestellt, weil nur so die Schüler angeblich begreifen, wofür man Schriftsprache braucht. Das wird heute als notwendig angesehen, denn nur wenn man wisse, wozu etwas gut ist, sei man auch motiviert. Ich sehe das völlig anders. Susanne Rieger entwickelt die Anlauttabelle sogar zum Silbenbogen weiter, einem Monstrum, das alles andere als selbsterklärend ist.
Was generell in diesem Band fehlt, ist die Berücksichtigung der Handschrift. Dieses Wort kommt auch nur einmal im Text vor, und zwar bei Carl Ludwig Naumann auf Seite 209: „Man vergleiche miteinander etwa die Lesbarkeit der Handschrift und die Korrektheit von Wörtern …“ Bei meinen Schülern ist die Handschrift oft sehr schlecht und manchmal kaum lesbar. Warum? Weil sie die zu wenig üben, und sich beim Schreiben so anstrengen, dass sie die im Buch beschriebenen Analysen, Vergleiche und Ableitungen zum Erkennen der passenden Rechtschreibstrategien gar nicht durchführen (können). Die Anlauttabelle zwingt zudem zuerst zur Druckschrift und macht die Schreibschrift damit zweitrangig. Ein schwerer Fehler! Darauf aufmerksam macht z.B. Schulze-Brüning/Clauss, „Wer nicht schreibt, bleibt dumm“.
Beachtlich sind die verzweifelten Versuche, Logik in die Rechtschreibung zu bringen, damit sich die Schüler die Rechtschreibung durch Ableitung und Vergleichen erschließen können. Dazu ein schönes Zitat von Böhm/Mehlem auf Seite 120: „Der Gegensatz zwischen der vermeintlichen Willkür orthografischer Regelungen und dem Wunsch nach ihrer leichteren Lehr- und Lernbarkeit durchzieht die didaktische Literatur seit der Reformation.“ Wie wahr! Aber warum „vermeintlich“? Man stolpert immer über Ausnahmen und muss Merkwörter erkennen. Einen systematischen Wortschatzaufbau empfehlen manche Autoren, der muss aber gepaart sein mit der Rechtschreibung der Wörter, die der Schüler in seinen freien Texten schreibt. Meines Erachtens gelingt das in der Praxis nicht oft, denn man kann nicht stringent vom Einfachen zum Schwierigen bzw. zu den Ausnahmen vorgehen. Von der Beachtung der Ranschburgschen Hemmung kann da keine Rede sein. Zudem kommt mir die Auffassung, dass jede Lehrkraft die Schüler ganz individuell behandeln muss, etwas visionär vor, zumindest bei der derzeitigen Personalausstattung der Grundschulen. Gefordert wird außerdem, dass die Lehrperson die deutsche Sprache in allen Facetten ihres Aufbaus, der Rechtschreibung, Zeichensetzung und der Grammatik beherrschen muss. Ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht.
Das Buch gibt interessante Einblicke in die Gestaltung eines modernen Rechtschreibunterrichts. Man erfährt etwas über Wörterkliniken, Klassenwörter, Klassentagebuch, Rechtschreibgespräche, Schreibkonferenzen, Forscheraufträge u.v.a.m. Jetzt weiß ich auch, wo das schreckliche Wort von der Erwachsenenschreibung (Beate Leßmann, Seite 139) herkommt und der Euphemismus „Privatschreibung“.
Küspert, Petra - Legasthenie vermeidbar
Küspert, Petra – Legasthenie vermeidbar
Petra Küspert, Neue Strategien gegen Legasthenie, Lese- und Rechtschreibschwäche: Erkennen, Vorbeugen, Behandeln, ObersteBrink Eltern-Bibliothek, 3. Auflage 2005
Frau Dr. Küspert ist Diplom-Psychologin und zertifizierte Dyslexietherapeutin (bvl), Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie e.V., Lehrbeauftragte an den Universitäten Würzburg und Chemnitz und führt laufend Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Kinderärzte durch.
Das Buch enthält interessante Geschichten über Kinder bzw. deren Eltern und ist wirklich lesenswert. Man erfährt viel darüber, wie Kinder Lesen und Schreiben lernen, über Warnsignale und wie man helfen kann. Ich konzentriere mich hier nur auf einen Aspekt und zitiere zunächst einen Satz, der jeden Verantwortlichen zum Nachdenken bringen müsste. „Die Einschulung ist nicht die Stunde Null für das Lesen- und Schreibenlernen.“ Und dann ein paar Sätze weiter: „In sehr vielen Fällen können wir die Kinder im Vorschulalter sogar spielerisch so fördern, dass ihnen das Schicksal einer Legasthenie erspart bleibt.“ Das heißt doch, dass die Ursache der Legasthenie das Ausbleiben einer notwendigen und möglichen Förderung der Kinder ist.
Bestärkt wird dieser Gedanke durch einen ausführlichen Bericht über ein Forschungsprojekt an der Universität Würzburg, an dem die Autorin maßgeblich mitgewirkt hat: Dort wurden zwei Gruppen von Vorschulkindern ca. 8 Monate vor der Einschulung gebildet. In einer Gruppe waren 200 Vorschulkinder, die an den Fördermaßnahmen teilnahmen, in der anderen Gruppe, der Kontrollgruppe, waren 150 Kinder, die nicht gefördert wurden. Im Vortest war die Gruppe, die speziell trainiert werden sollte, etwas schlechter beim phonologischen Bewusstsein (Durchschnittswerte, Kontrollgruppe 17 : 15 Fördergruppe). Nach dem Training war die Fördergruppe signifikant besser (19 : 29). Und am Ende des zweiten Schuljahrs sah es so aus: Lesen (77 : 82) und Schreiben (16 : 20). Die Autorin fasst zusammen: „Und das Wichtigste (zum Förderprogramm): Die Kinder in der Trainingsgruppe konnten vor dem Schicksal einer Legasthenie bewahrt werden. Denn in der Trainingsgruppe waren auch Legasthenie-Risikokinder, die im Vorschulalter mittels bestimmter Tests ausgewählt worden waren. Für diese Risikokinder hatte nun die über 90-prozentige Sicherheit bestanden, dass sie eine Legasthenie entwickeln. Tatsächlich konnte man fast alle Kinder mit einer erweiterten Trainingsversion vor diesem Schicksal bewahren.“ Mit den Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass man eine Legasthenie „entwickeln“ kann, muss ich mich noch gesondert beschäftigen.
Das war für mich das Wichtigste aus diesem Buch. Als Betriebswirt frage ich mich, warum man mit den Ergebnissen des zitierten Forschungsprojekts nicht mehr anfängt. Warum, um in der Sprache der Betriebswirtschaft zu reden, steckt man nicht mehr Zeit und Geld in die Qualitätssicherung, sprich Vorbeugung? Erste Politiker haben ein Umdenken angedeutet. Neulich hörte ich Frau Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, in einer Talkshow spät am Abend sinngemäß sagen, dass sie trotz des Rückgangs der Schülerzahlen keine Lehrerstellen abbauen will, sondern im Gegenteil mehr in Bildung investieren will, um die viel aufwendigeren Nachbesserungen einzusparen. Respekt! Hoffentlich vernehmen wir in Zukunft solche Sätze von unseren Bildungspolitikern öfter. Und hoffentlich sehen wir auch Taten!
Lembke, Gerald, Leipner, Ingo – Die Lüge der Digitalen Bildung
Gerald Lembke, Ingo Leipner – Die Lüge der Digitalen Bildung – Warum unsere Kinder das Lernen verlernen – Redline Verlag- 4. Auflage 2020 – ISBN 978-3-86881-697-6
Den Teil 1 „Kleinkinder, Kindergarten und Grundschule“ könnte ich mir gut als Pflichtlektüre für Eltern vorstellen. Unter dem, gleich im Vorwort schon kurz erläuterten Motto „Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter“ wird überzeugend dargestellt, welche Nachteile es für das Kind bringt, wenn man es zu früh den digitalen Medien überlässt.
Eine schöne Erklärung für meine Beobachtung, dass meine Lesekinder einen viel zu geringen Wortschatz haben, findet sich auf Seite 19: „Die destruktive Wirkung von Background Media – Kleinkinder werden einem Fernsehprogramm kaum aufmerksam folgen, wenn sie es nicht verstehen. Aber die Eltern sind damit beschäftigt. Der Fernseher mag für das Kind nur ein Hintergrund-Medium sein, doch für die Eltern steht er im Vordergrund. Der Fernseher lenkt die Eltern ab – und verringert die Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das Wachstum seines Wortschatzes hängt aber direkt von der ´talk-time´ mit den Eltern ab bzw. von der Zeit, die Vater oder Mutter mit ihm sprechen. Wird in einem Haushalt sehr viel ferngesehen, kann sich das negativ auf die Sprachentwicklung des Kindes auswirken, einfach weil die Eltern wahrscheinlich zu wenig mit ihrem Kind sprechen.“
Dieses Beispiel – eines von vielen in diesem Buch – soll nur zeigen, wie anschaulich das Thema behandelt wird. Und es wird gnadenlos mit häufig gehörten Allgemeinplätzen aufgeräumt, z.B. dass das Fernsehen den Kindern beim Einschlafen hilft. Sehr gut wird auch an Beispielen erklärt, wie moderne Medien Kinder auf scheinbar harmlose Weise binden und manipulieren. Grundsätzlich heißt es im Buch zu Medienkonsum durch Kleinkinder: „Vor einem Bildschirm verharrt das Kind in relativer Ruhe, sein Bewegungsdrang wird gedämpft und wesentliche motorische Erfahrungen bleiben aus.“ Und: „Was auf dem Bildschirm erscheint, sei niemals die Sache selbst, sondern nur ein Surrogat der Realität.“ Und auf Seite 35: „Je länger Kinder vor digitalen Spielzeugen sitzen, desto weniger erleben sie die reale Welt. Mit allen negativen Konsequenzen für ihre kognitive Entwicklung! Was sie scheinbar fördert (Anm. Siegbert Rudolph: gemeint mit scheinbar ist die Werbung für mediale Produkte für Kinder), untergräbt ihre Fähigkeit, die Welt zu entdecken. Digitalität statt Realität …“ Und immer wieder kommt das Beispiel vom Hausbau, das im Keller mit dem Fundament beginnen sollte, was bei der Mediennutzung oft nicht beachtet wird.
Am Ende jedes Kapitels kommt das Gehirn zu Wort, was eine gelungene kurze Zusammenfassung des Kapitels ist.
Auch ein roter Faden im Buch: „Kinder erleben in unserer Welt genug Digitalität. Da ist es kontraproduktiv, den Umgang mit Computern in Kindergarten und Schule zu fördern.“
Besonders gefällt mir, wie sich die Autoren mit der frühen Medienkompetenz auseinandersetzen, die allerorts gefordert wird. Zum Beispiel sagen die Autoren, statt viel Geld für fragwürdige Digitaltechnik auszugeben, solle man doch besser in dringend benötigte Köpfe investieren. Und auch das Beispiel des Hauses, das von unten nach oben gebaut wird, kann hier wieder bemüht werden.
Auch E-Learning stellen die Autoren besonders im zweiten Teil des Buches infrage. Die Entwicklung der Empathie leide durch häufige Nutzung von Bildschirmmedien bei Kindern, heißt es dazu. Als jemand, der seine Lese- und Rechtschreibförderung weitgehend mit dem Computer betreibt, hat mich das natürlich besonders interessiert. Es wird darauf hingewiesen, dass für E-Learning vor allem damit geworben wird, dass es Feedback und Wertschätzung durch das Programm gibt. „Beides gewinnt aber erst seinen wahren Wert, wenn echte Menschen ein ernst gemeintes Lob aussprechen oder freundlich Kritik üben.“ Die intrinsische Motivation werde beim E-Learning gestört, weil dabei das Verhalten als kontrolliert und abhängig von einer Belohnung erlebt wird. Und da fühle ich mich dann mit meinem System bestätigt, denn ich entwickle nicht E-Learning, sondern Hilfen für Eltern und Trainer, mit Kindern gezielt üben zu können. Die Kinder sollen bei meinen Übungen – außer bei Vertiefungsübungen zur Rechtschreibung – nicht allein vor dem Computer sitzen.
Und dann bin ich sehr verwundert über einen Beitrag zur Motivationsforschung. Da wird doch glatt Douglas McGregor zitiert. Von dem habe ich Bücher als Student gelesen, und das ist lange her. Scheint doch nicht alles überholt zu sein, was ich gelernt habe.
Ein schöner Satz von Seite 117: „Wer dicke Bretter bohren kann, ist beim Lernen erfolgreich!“
Und dann kommt noch ein Zitat, das mir besonders auffällt, weil es von meinem Ex-Kollegen aus DATEV-Zeiten stammt, der in seiner Eigenschaft als Präsident des Bitkom eine „digitale Agenda für unsere Schulen“ gefordert hat. Ich kann dazu nur sagen, dass man bei Organisationen wie Bitkom nicht in pädagogischen, sondern in Markterschließungs- und Absatzkategorien denkt und Kinder als zukünftige Nutzer sieht. Gefährlich ist das nur, wenn Bildungspolitiker auf solche Thesen hereinfallen, was leider häufig der Fall ist.
Gefreut hat mich auch, dass Josef Kraus zitiert wird, der die Entwicklung ähnlich sieht. Ein Werk von ihm (Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt) habe ich auch schon rezensiert.
Immer wieder wird auch darauf hingewiesen, dass der Lehrer den Lernerfolg bestimmt. Dazu wird John Hattie zitiert.
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie das Gehirn“ rundet das lesenswerte Buch ab.
Liessmann, Konrad Paul - Geisterstunde
Liessmann, Konrad Paul – Geisterstunde
„Analphabetismus als geheimes Bildungsziel“, dieser Artikel von Konrad Paul Liessmann in der FAZ vom 24. September 2014 hat mich zur sofortigen Bestellung des dort angekündigten Buches bewogen.
Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung – Eine Streitschrift von Konrad Paul Liessman – Paul Zsolnay Verlag – 2014
Ich fördere als Quereinsteiger junge Menschen mit Leseschwierigkeiten und versuche, nicht nur zu helfen, sondern auch zu ergründen, warum diese Probleme so zunehmen. Deshalb hat mich dieser FAZ-Artikel und dann auch das Buch so fasziniert. Vieles von dem, was ich in der Praxis mit großem Erstaunen zur Kenntnis nehme und manchmal gar nicht glauben will, weil es mit meiner Erfahrungswelt und mit dem gesunden Menschenverstand überhaupt nicht zu vereinbaren ist, bringt der Autor auf den Punkt. Ich habe das Buch in einem Zug verschlungen.
Vorher habe ich mich mit dem neuen LehrplanPlus beschäftigt, und dabei fielen mir Formulierungen auf wie:
• „Die Schülerinnen und Schüler bringen Kompetenzen mit, die sie lange vor Schuleintritt erworben haben …“ – Kompetent war ich auf der Höhe meiner Berufslaufbahn, aber sicher nicht als Grundschüler. Da hatte ich auch keine Kompetenzen, aber ich konnte sehr gut lesen, schreiben und rechnen.
• „Schülerinnen und Schüler fassen ihre Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse in Worte und tauschen sich darüber aus, um durch solche bewussten Rückblicke ihr eigenes Lernen zunehmend selbst zu planen und zu steuern.“ – Will man so die Lehrer entlasten? Es geht hier um Grundschüler, nicht um Trainees in modernen Großunternehmen.
• „Rechtschreibübungen finden nicht isoliert und ohne Anwendungsbezug statt, sondern sind eingebunden in sinnvolle Kontexte wie das Verfassen und Überarbeiten eigener und gemeinsamer Texte.“ – Ein Wort fünf- oder zehnmal zu schreiben, ist offensichtlich verpönt, obwohl das am wirksamsten ist. Wenn man ein Wort nur einmal korrigiert, setzt es sich nicht so sicher im Gedächtnis fest. Und wie „gemeinsame Texte“ entstehen, will ich mir lieber gar nicht vorstellen.
Das sind nur Beispiele. Die neuen Methoden haben viele Anhänger. Wenn man Kritik daran übt, gilt man schnell als reaktionär. Die Lektüre der „Geisterstunde“ hat mich wieder zuversichtlich gemacht. Ich bin nicht der Einzige, der die Praxis der Kompetenzorientierung nicht mit Bewunderung, so wie viele das tun, sondern mit Verwunderung beobachtet.
Der Autor beschäftigt sich in 11 Kapiteln mit der aktuellen Bildungsentwicklung, z. B.:
• mit der Outputorientierung und der operativen Hektik durch PISA,
• mit Bildungsexperten, die nach dem Motto „Alles oder Nichts“ vorgehen,
• mit der Kompetenzorientierung und dem damit verbundenen Verschwinden von Wissen und Bildung,
• mit der Vermischung von Fächern und der damit einhergehenden Verflachung des Unterrichts,
• mit dem exzessiven Einsatz von PowerPoint, bei dem die Folien wichtiger sind als der Inhalt der Rede,
• mit den Grenzen von Suchmaschinen, weil die Suchergebnisse oft gar nicht eingeordnet und bewertet werden können und weil man oft auch aufgrund von fehlendem Wissen gar nicht erkennt, dass man eigentlich im Netz recherchieren müsste.
• mit den Konsequenzen der Bologna-Reform, die zu einer Verschulung der Bachelor-Studiengänge geführt hat,
• und mit dem um sich greifenden Analphabetismus, der als Skandal einer modernen Zivilisation angeprangert wird.
Das sind Themen, die kritisch und für mich als Praktiker überzeugend beschrieben werden. „Dabei wäre alles ganz einfach“, so endet jedes Kapitel, also mit Hinweisen darauf, wie es sein könnte. Zum Beispiel müsste man aus der Kompetenzorientierung keine Doktrin machen. Und beim Erwerb der Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben sollte man all jene, die Schwierigkeiten damit haben, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, damit sie wirklich lesen und schreiben lernen. Ich hoffe, dass viele Menschen, die mit dem Bildungswesen zu tun haben, dieses Buch lesen und dass die „Streitschrift“ eine Diskussion und ein Umdenken auslöst.
Margil, Irene - Lies mal vor!
Margil, Irene – Lies mal vor!
Irene Margil – Lies mal vor! Vorlesetipps vom Profi für alle von 9 bis 99 – Carlsen – ISBN 978-3-551-18947-9 – € 7,99
Als ich dieses Buch vor mir hatte, fragte ich mich zunächst, wie man zu diesem Thema ein ganzes Buch schreiben kann. Aber dann entdeckte ich viele Punkte, die ich mir früher selbst erarbeitet habe. Ich durfte viele Vorträge halten, zu den unterschiedlichsten Anlässen. Einer meiner Sprüche war immer: 80 Prozent des Erfolgs ist die Vorbereitung. Auf Vorlesen – viele Reden werden ja auch vorgelesen – trifft das auch zu.
Schon der erste Tipp im Buch von Frau Margil ist ein Volltreffer: „Den Text auswählen“. Wie oft wird über das Publikum hinweggeredet. Ich habe erlebt, dass Redner ihren Vortrag mehrmals halten, obwohl das Publikum jeweils einen ganz anderen Hintergrund hat. Den nächsten Tipp, der die Textmenge betrifft, habe ich zu Beginn meiner Karriere auch nicht immer beachtet, weil ich dachte, ich müsse so viel wie möglich an Details liefern. Damit aber werden die Zuhörer überfordert. Und nach einigen Reden habe ich es genauso gemacht, wie der Tipp 5 von Frau Margil empfiehlt: „Wählt eine große Schrift und einen großen Zeilenabstand, teilt euren Text in kleine Einheiten auf und beginnt jeweils neue Zeilen, besonders bei wörtlicher Rede …“ Ganz wichtig ist, dass man auch erfährt, was man bei Zwischenfällen tun kann. Das sind nämlich Chancen, und das bringt die Autorin Neulingen bei.
Die 44 Tipps sind anschaulich geschrieben, lassen sich schnell lesen und meistens auch leicht umsetzen.
Mein Fazit: Für alle kleinen und großen Redner, die sich Vorlese- oder Vortragspleiten ersparen wollen, eine nützliche Lektüre.
Toll: Es gibt auch ein Angebot für Vorträge.
Naegele, Ingrid - Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen
Naegele, Ingrid – Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen
Der Satz könnte von mir sein, aber es ist der Titel eines Buches von Ingrid Naegele.
Ingrid Naegele, Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen – LRS, Legasthenie, Rechtschreibschwäche – Wie Eltern helfen können – Beltz Verlag, 1. Auflage 2011
Frau Naegele spricht nicht mehr von Legasthenie, sondern bezeichnet die „erwartungswidrige Entwicklung der Schriftsprache, ausgelöst durch fehlende oder unpassende Vorstellungen des Kindes über unser alphabetisches Schriftsystem“ einfach „nur“ als Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS). (Anmerkung: diese Abkürzung bedeutet ansonsten Lese-Rechtschreibschwäche, und wird gemeinhin als die leichtere Form der Legasthenie angesehen. Über die Definition von LRS und Legasthenie werde ich später einen Beitrag in meinem Blog bringen.) Meine Erfahrungen mit dem Thema sind zahlenmäßig noch recht gering, decken sich aber mit denen, die Frau Naegele wissenschaftlich und praktisch fundiert in ihrem Buch darstellt. Ich kann das Buch deshalb den Eltern – auch meiner Schüler – sehr empfehlen. (Ich habe mich bisher überwiegend der Verbesserung der Lesekompetenz meiner Schüler gewidmet, das Buch enthält sehr gute Hinweise auch für die Verbesserung des Schreibens.)
Im Buch finden sich Eingangsfragen, die den Istzustand des Kindes ermitteln helfen. Die Autorin stellt in der Zusammenfassung dieses Kapitels u.a. fest: „Auch gravierende Probleme beim Lesen und Schreiben sind keine Krankheiten!“ Die Folgen eines medizinischen Verständnisses der Legasthenie werden folgerichtig als kontraproduktiv dargestellt. Die sogenannten Teilleistungs- und Wahrnehmungsstörungen, von denen ich auch in anderen Büchern gelesen habe, müssen beim medizinischen Ansatz als Ursache für die Krankheit Legasthenie herhalten. Wer der These von Frau Naegele – so wie ich – zustimmt, der muss aber auch wissen, dass etwas unternommen werden muss, um Verbesserungen zu erzielen. Schließlich kann man sich nicht auf eine schicksalhafte oder genetisch bedingte Krankheit berufen.
Ausgangspunkt, Zitat: „Die Gründe, warum eine Reihe von Kindern den Zugang zur Schriftsprache so qualvoll erlebt, sind individuell unterschiedlich, haben aber immer mit fehlender kognitiver Klarheit über unser Schriftsystem oder falschen Vorstellungen darüber zu tun.“ Frau Naegele stellt fest: „LRS ist keine Beeinträchtigung der Lernfähigkeiten, sondern eine Beeinträchtigung der Lernmöglichkeiten, die dadurch entsteht, dass Kinder keine ´kognitive Klarheit´ haben.“
Auch folgender Satz stimmt mit meinen Erfahrungen überein: „Kinder mit LRS halten sich länger auf den unteren Ebenen der Entwicklung der Schriftsprache auf, was zu vielen Fehlern beim Schreiben und unzureichenden Lesestrategien führt.“ (Anmerkung: Dazu habe ich in meinem Erfahrungsbericht bereits etwas ausgeführt.)
Einer der vielen nützlichen Tipps für die Eltern ist: „Üben kurz und effektiv: je nach Alter 5-mal eine Viertelstunde bis zwanzig Minuten die Woche“. Ich finde, das wäre toll. Es geht aber nur durch Einbeziehung der Eltern in den Förderprozess. (Anmerkung: Mein wöchentliches Training in der Schule könnte durch kurze Telefontrainings unterstützt werden, wenn sich das organisieren lässt.)
Mein Lieblingssatz kommt in diesem Buch auch vor: „Lesen lernt man nur durch Lesen! Schreiben nur durch Schreiben!“ Und auch das von mir empfohlene „Lesen und Hören von CD“ wird von der Autorin erwähnt. (Anmerkung: Bei der Bücherkiste Emskirchen – siehe Startseite meines Internetauftritts – gibt es so etwas.)
In zwei Punkten möchte ich klarstellende Ausführungen machen.
Frau Naegele hält ein Einzelwort-Lesetraining, bei dem die Wörter nicht im Kontext von Sätzen stehen, für nicht hilfreich. In meinen Übungen kommt das vor, aber immer nur im Zusammenhang mit einem Übungsartikel, in dem die Wörter vorkommen. Das ebenfalls nicht empfohlene Training sinnloser Silben und Wörter halte ich in zwei Fällen für sehr nützlich: Wenn ein Schüler generell Probleme mit Silben hat oder wenn er Buchstaben verwechselt. Mit dem Einzelworttraining von Wörtern aus dem vorher gelesenen Artikel habe ich bei allen meinen Schülern gute Fortschritte erzielt. Silbenübungen habe ich bisher nur bei wenigen Schülern gebraucht. Die Übungen haben den Schülern auch Erfolgserlebnisse vermittelt. Und was aus meiner Sicht besonders interessant ist: Es wird bei einzelnen Wörtern oder Silben viel weniger geraten, als das bei einem Fließtext der Fall ist.
Wichtig ist auch das Schreiben mit der Hand! Ich möchte dazu anmerken, dass viele Schüler damit große Probleme haben, weil in den Schulen das Schreiben nicht mehr richtig geübt wird. Die Folgen werden von Frau Naegele ausführlich beschrieben und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt.
Abschließend noch ein schönes Zitat:
„Sind Fehler wichtig? Ja! Denn aus Fehlern wird man klug, wie schon das Sprichwort sagt. “ Das sollten wir uns alle merken, nicht nur bei Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten der Kinder.
Naegele, Ingrid - Praxisbuch LRS
Naegele, Ingrid – Praxisbuch LRS
Naegele, Ingrid – Praxisbuch LRS – Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden – BELTZ 2014 – ISBN 978-3-407-62844-2
Von dieser Autorin habe ich schon ein anderes Buch (Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen) mit Begeisterung gelesen. Dieses Buch beginnt mit „Liebe Kollegin, lieber Kollege“, d.h., das Buch wendet sich nicht an Laien, sondern an Fachleute. Die Autorin gibt ihre langjährigen Erfahrungen weiter. Davon kann man wirklich profitieren.
Die Autorin verwendet die Abkürzung LRS für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Sie ist – wie ich mit meiner bescheidenen Praxis – auch zu der Überzeugung gekommen, dass die Unterscheidung für die Förderung der betroffenen Kinder keinen Sinn ergibt.
Das Buch zeichnet sich durch zahlreiche Schilderungen von Schülern und Jugendlichen aus, die über ihre Probleme berichten. Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass ein ganz wichtiger Gesichtspunkt bei der Lese- und Rechtschreibförderung die Motivation ist. Unkenntnis der Probleme führt bei vielen Kindern zu Frust und mangelndem Selbstwertgefühl.
Die einzelnen Kapitel können auch unabhängig voneinander durchgearbeitet werden.
1) Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, was Lehrer über LRS wissen müssen. Es gibt einen kurzen geschichtlichen Rückblick zur Legasthenie. Ich lese immer wieder gerne die wissenschaftliche Begründung von Fachleuten, die mir zeigen, dass ich mit meinen praktischen Erfahrungen richtig liege.
Zitat: „Es ist alarmierend und bedrohlich, wenn jährlich fast 20 Prozent der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler (Ergebnis PISA 2009) in Deutschland ohne ausreichende Lese- und Schreibkompetenz die Schule verlassen ….“ Die Autorin kritisiert, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zunächst als Beeinträchtigung der Lernfähigkeit betrachtet werden, z.B. als Teilleistungsstörung, und nicht als Beeinträchtigung der Lernmöglichkeiten. Sie rät den Lehrern, wenn Schwierigkeiten deutlich werden, nicht einfach abzuwarten, bis der Knoten platzt. Es wird sehr schön beschrieben, welche Faktoren zu einer LRS beitragen können.
Zitat: „Keinesfalls darf den Kindern vermittelt werden, unsere Schrift sei eine Lautschrift.“ Genau das passiert aber in den ersten beiden Grundschuljahren. Über die Folgen muss man sich nicht wundern.
Die Autorin macht begrüßenswerte Vorschläge für günstige Rahmenbedingungen zur Förderung von Kindern mit LRS. Die Autorin setzt sich auch mit dem medizinischen Verständnis von Legasthenie auseinander. Sie hält diesen Ansatz für verhängnisvoll und begründet das überzeugend. Die Kinder brauchen unterschiedlich lange für die einzelnen Phasen des Schriftspracherwerbs. Leider wird darauf kaum Rücksicht genommen.
Zum Schluss des Kapitels wird die Wichtigkeit der Motivation betont.
Die weiteren Kapitel sind wie folgt überschrieben:
2) Wie kann LRS festgestellt werden?
3) In welchen Bereichen brauchen Lehrkräfte Fachwissen?
Eine Liste mit Negativ-Zitaten von Lehrern macht sicher den einen oder anderen nachdenklich. Die Autorin gibt viele nützliche Tipps.
4) Welches metakognitive Wissen brauchen Kinder mit LRS?
Es gibt eine schöne Liste mit Hinweisen zum richtigen Üben. Vorrangig ist der Einsichtsprozess beim Kind. Auszug aus den weiteren Punkten: Loben, auch kleinster Fortschritte, wird gleich danach genannt. Wiederholungen sind wichtig. Übungen sollen abwechslungsreich sein. Fehler sind sofort zu korrigieren. „Echtgemeinte positive Kommentare beflügeln die Lernmotivation.“
5) Wie kann LRS im Anfangsunterricht vermieden werden?
6) Wie können Kinder mit LRS in der Grundschule gefördert werden?
7) Wie kann älteren Schülerinnen und Schülern mit LRS geholfen werden.
8) Was können Lehrkräfte Eltern raten, um ihr Kind zu unterstützen?
Als Unterstützung für die Rechtschreibung empfiehlt die Autorin insbesondere die Arbeit mit einer Lernkartei. Das finde ich praxisgerecht und leicht realisierbar. Damit könnten Eltern ihr Kind gut unterstützen.
9) Was ist bei außerschulischen LRS-Therapien wichtig? Die Autorin stellt hier ihr FIT-Konzept (Frankfurter integrative Therapie) vor, das aus sechs Bausteinen besteht.
Individueller Förderplan
Gezielte Förderung des Lesens, Schreibens und Rechtschreibens
Gesprächs- und spieltherapeutische Unterstützung
Für das Kind nachvollziehbare Therapiestruktur mit festen Ritualen
Begleitende Gespräche mit den Eltern und Lehrkräften, regelmäßiges häusliches Üben
Einbezug geeigneter Medien und Materialien
10) Wie kann einem Kind bei drohendem Analphabetismus geholfen werden?
Naegele, Ingrid M. - Schulerfolg trotz LRS
Naegele, Ingrid M. – Schulerfolg trotz LRS – 2017 – Beltz-Verlag
Ein weiterer Ratgeber für Eltern zum Thema LRS – was ist das Besondere daran? Sofort begeistert haben mich die vielen Schilderungen aus der Praxis. Was hier von Eltern, Kindern, Lehrern und von der Autorin berichtet wird, macht das Buch schon lesenswert. Deutlich wird, dass Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten kein lebenslanges Schicksal sein müssen, wie oft behauptet wird. Die Autorin ist, wie ich auch, der Meinung, dass die medizinische Sichtweise zur Erklärung der Legasthenie in die Irre führt. Sie spricht von „Beeinträchtigungen der Lernmöglichkeiten, die dadurch entstehen, dass Kindern im Anfangsunterricht keine klaren Vorstellungen über den Lerngegenstand Schriftsprache vermittelt werden.“ Dazu wird u.a. ausgeführt, „dass sich Kinder am Schulanfang um bis zu drei Jahre in ihrer kognitiven Entwicklung unterscheiden können. Daher braucht eine Reihe von Kindern viel mehr Zeit in den ersten Schuljahren zum Entdecken der Schriftsprache und gezielte Förderung entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, als Schulbürokratie und Eltern bereit sind zu investieren.“ Die Eltern erhalten leicht umsetzbare Tipps, wie sie ihren Kindern helfen können, z.B. mit Spielen, mit bestimmten Ritualen, die den Wortschatz erweitern und das Schreiben fördern, bekommen aber auch die Frage gestellt, ob sie die notwendige Geduld haben, die für einen Erfolg unbedingte Voraussetzung ist. Deswegen werden auch andere Fördermöglichkeiten ausführlich behandelt. Hilfreich im Buch ist auch der Anhang mit Links und Hinweisen auf Materialien zur Förderung.
Spezielle Anmerkungen für Nutzer meines Übungssystems, die aber meine Zustimmung zu diesem Buch nicht schmälern:
Die Autorin sagt auf Seite 122, dass ein Einzelwort-Lesetraining nichts bringe. Ich binde das Einzelwort-Training grundsätzlich in meine Übungen ein. Wörter aus dem gelesenen Text werden dabei wiederholt. Das gibt den Schülern Sicherheit und auch Erfolgserlebnisse. Außerdem ist ja auch das von der Autorin empfohlene Blitzlesen ein Einzelwort-Training. Ich übe auch gerne mit Fantasiewörtern, was insbesondere bei der Ratetechnik hilft sowie bei immer wieder falsch gelesenen Buchstabenkombinationen. Wenn einem Trainer bestimmte Übungstypen nicht gefallen, sollte er sie einfach weglassen. Der Erfolg hängt auch von der Überzeugung des Trainers ab. Ich erkläre den Schülern immer, was ich mit dem Übungstyp bezwecke, und stelle oft Vergleiche mit dem Training von Sportlern an. Das überzeugt die Schüler immer. Und die erwähnten Übungen kann man so gestalten, z.B. durch die Einstellung der Geschwindigkeit, dass die Schüler Erfolgserlebnisse haben.
Auf Seite 140 erwähnt die Autorin in Zusammenhang mit der orthografischen Strategie die sogenannte Übergeneralisierung. Das ist ein Fachbegriff, den Experten eingeführt haben, weil Kinder die Regeln auch dort anwenden, wo sie gar nicht notwendig sind, ja zu Fehlern führen. Ich halte diesen Begriff für zynisch, denn er macht deutlich, dass die Rechtschreibung eben nicht mit eindeutigen Regeln gelernt werden kann. Nicht die Übergeneralisierung ist die Ursache für Probleme, sondern dass man glaubt, mit generellen Regeln die Rechtschreibung vermitteln zu können.
Seite 157: Die erwähnte Ranschburgsche Hemmung gilt natürlich nur für das Erstlernen. Wenn die verschiedenen Phänomene einzeln gelernt wurden, sind Übungen, die die Kenntnis der Unterscheidung fordern, durchaus sinnvoll.
Beim Schultyp vermisse ich als Bayer die Mittelschule. Sie wird leider oft als Restschule bezeichnet und hat einen schlechten Ruf. Ich habe aber viele wirklich gute Schüler auch an der Mittelschule kennengelernt. Sie machen z.B. Leseförderung mit meinen Übungen mit Schülern der 5. und 6. Klassen. Alle gehen auf den sogenannten M-Zweig. Etliche davon gehen anschließend auf die FOS. Da unser Schulsystem so durchlässig ist, was die Schultypen anbetrifft, so finde ich es besser, ein Schüler steigt auf, als dass er absteigen muss. Ich setze mich für einen besseren Ruf der Mittelschule ein. Die Mittelschule ermöglicht gerade Spätzündern, sich über die Mittlere Reife alle Chancen offenzuhalten.
Schulrechtliche Bestimmungen (Seite 56): In Bayern wurde mit diesem Schuljahr die Unterscheidung zwischen LRS und Legasthenie abgeschafft. Frau Naegele macht – wie ich auch – keinen Unterschied zwischen diesen angeblich verschiedenen Formen.
Seite 251, Häufigkeitswörter: Diese Übung habe ich mit meinem Blitzlesemakro als Übung unter „Ab 2. Klasse / Besondere Übungen / Wörter – Blitzlesen – Häufigkeitswörter lt. Naegele“ zum Download bereitgestellt. Damit können alle Wörter geübt werden, die letzte Staffel enthält die als „häufige Fehler“ gekennzeichneten Wörter.
Omer, Haim und Streit, Philip - Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern

Omer, Haim / Streit, Philip- Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern – Vandenhoeck & Ruprecht – ISBN 978-3-525-49158-4
Auf die „Neue Autorität“ bin ich in einer Besprechung meines Vereins 1-2-3e.V., einem Präventionsverein, aufmerksam geworden. Eine Lehrerin berichtete im Ausschuss Familie und Schule über ein neues Schulteam, das sich speziell um Systemsprenger kümmert und dabei auf die Neue Autorität setzt. Als eine Maßnahme hat die Lehrerin die Deeskalation benannt. Das Team hat viele neue Kompetenzen, zum Beispiel können die Teammitglieder, Pädagogen, Schulpsychologen und Sozialarbeiter, zu den Schülern nach Hause gehen und den Unterricht auch außerhalt der Schulgebäude durchführen.
Ich kannte den Begriff „Neue Autorität“ nicht. Das Adjektiv „neue“ hat mich auch etwas erstaunt, denn Deeskalation habe ich als Manger oft angewandt. Schließlich kann es kontraproduktiv sein, einen Streit zu gewinnen, wenn man mit dem Streitgegner weiter zusammenarbeiten muss. Alternative Autorität hätte mir besser gefallen, denn zu deeskalieren ist in der Praxis doch eher die Ausnahme.
Das Buch richtet sich an Eltern. Es ist ein Beispielbuch! Zu jedem Prinzip gibt es zahlreiche Schilderungen aus dem Familienalltag.
Es geht zuerst um die Struktur, um die Ordnung, die Eltern einführen müssen. Dann um Präsenz, Selbstkontrolle und Deeskalation sowie Unterstützung. Beim letzten Punkt wird beschrieben, wie Eltern ein Unterstützernetzwerk aufbauen können. Ein Kapitel über Widerstand als Alternative zur Strafe und Ausführungen über die Kunst der Wiedergutmachung runden das Buch ab.
Wenn die Grundsätze dieses Buches in allen Familien zum Einsatz kämen, hätte das neue Schulteam bald nichts mehr zu tun.
Reichen, Jürgen - Hannah hat Kino im Kopf
Jürgen Reichen – Hannah hat Kino im Kopf – Die Reichen-Methode LESEN DURCH SCHREIBEN – Heinevetter Verlag Hamburg – 7. Auflage – 2017
Jetzt „weiß“ ich, dass ich nicht wegen, sondern trotz eines Fibelunterrichts das Lesen gelernt habe. Ich habe, damals in der Volksschule, laut Jürgen Reichen nämlich nur das Entziffern beigebracht bekommen. Nach der Lektüre dieses Buches ist mir noch weniger klar als vorher, warum sich die Reichen-Methode so verbreiten konnte.
Kurzfassung der Methode, Zitat von Seite 9: „Daher geht es im Erstleseunterricht um mehr als nur ums Lesenlernen und deshalb ist Lesen durch Schreiben eigentlich erst in zweiter Linie ein ´Leselehrgang´. In erster Linie handelt es sich um den Versuch, dem Kind vom ersten Schultag an einen offenen, kommunikativen und kindgemäßen Unterricht zu ermöglichen, in dem es nicht nur das Lesen, sondern vor allem auch das Lernen und das Denken lernen darf.“
Fortsetzung auf Seite 29: „Lesen durch Schreiben steht auf der pädagogischen Grundüberzeugung, dass die meisten Kinder aus sich heraus lernfähig und lernbereit sind und viele didaktisch-methodische Maßnahmen der Schule das kindliche Lernen vermutlich eher stören als unterstützen – Kinder lernen um so mehr, je weniger sie belehrt werden. Leitend ist eine psycholinguistische Hypothese, die besagt, dass im Bereich des Lesenlernens der Anteil von Nachahmungsleistungen, d.h. die Aneignung und Übernahme lesetechnischer Verfahrensweisen, sehr gering ist. Kinder erwerben die Kompetenz zum Lesen und Schreiben durch aktive innere Gestaltungsprozesse, nicht durch didaktisch aufgezwungenes Buchstabentraining. Entsprechend wird bei Lesen durch Schreiben der Selbstaktivität des Kindes ein Maximum an Spielraum gelassen. Die unumgänglichen Anteile rezeptiven Lernens sind klein gehalten.“
Mir gefällt das Wort Hypothese in diesem Absatz, denn die Gültigkeit der Aussage ist wissenschaftlich weder bewiesen noch verifiziert. Mein Verstand sagt mir, dass das Quatsch ist, denn Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, die sich das Kind nicht selbst erarbeiten kann. Ein in einer kommunikativen Umgebung aufgewachsenes sechsjähriges Kind kann die Grammatik der deutschen Sprache fehlerfrei anwenden, ohne eine Regel zu kennen. Warum? Weil es die Erwachsenen jahrelang nachgeahmtt hat.
Weitere Fortsetzung auf Seite 32: „Lesen durch Schreiben vermittelt dem Kind die Überzeugung, es selbst habe sich das Schreiben und Lesen beigebracht und nicht die Lehrerin.“ Frontalunterricht wird so beschrieben: „Alles hört auf mein Kommando.“
Anlauttabelle – Das Buch beschäftigt sich ausführlich mit der Anlauttabelle. Dabei taucht dann auch hier der Satz auf, der die Reformpädagogik durchzieht: „Kinder lernen umso mehr, je weniger sie belehrt werden!“ Deswegen gibt seine Methode dem Kind von Anfang an alle Buchstaben an die Hand. Das sei ein aktives Lernen, sagt Reichen, weil das Kind beim Schreiben selbst tätig wird, selbst festlegen kann, was und wie es schreibt, während beim Lesen rein rezeptiv vorgegangen wird. Eine Anlauttabelle kann aber nur eine Krücke sein. Denn nicht alle Laute kommen als Anlaute vor und vor allem: Es gibt Laute mit mehreren Verschriftungen. Zum Beispiel den F-Laut, der auch mit V verschriftet werden kann.
Weitere Anmerkungen zu Lesen durch Schreiben
Alles, was nach rezeptivem Lernen aussieht, wird von Reichen verteufelt. Er behauptet sogar, dass es schädlich ist, einem Kind eine Fibelseite noch einmal lesen zu lassen. Dabei würde das Kind nämlich nur üben, wie man Zeichen in Laute umwandelt, aber den Text nicht verstehen.
Reichen sagt, dass man vom Lesen nur dann sprechen kann, wenn man versteht, was man liest. Da kann man nur einen Haken machen. Warum er aber das laute Vorlesen so verteufelt, erschließt sich mir nicht. Wenn man das Lesen und Schreiben so gelehrt bekommt, wie ich vor mehr als 60 Jahren, dann lernt man Lesen und Schreiben getrennt. Lesen kann man alle Laute schon nach ein paar Wochen. Eigene Texte schreiben allerdings erst in der zweiten bzw. dritten Klasse. Warum? Weil wir als Schrift nicht Druckbuchstaben zu Papier brachten, sondern eine verbundene Schrift, die lateinische Ausgangsschrift eingeübt haben. Und das hat Zeit gebraucht.
Reichen geht es um das Verstehen des Textes. Er bringt ein tolles Beispiel: „Wenn in einer Geschichte über ein Mutterschwein und ihre Ferkel der Satz steht „Die Mutter säugte ihre Jungen“ und ein Kind liest „Die Mutter säugte ihre Kleinen“, dann sollte dies nicht als Fehler angekreidet werden, sondern als Beleg dafür genommen, dass das Kind den Sinn des Satzes verstanden hat.“ Damit, und in seinen nachfolgenden Ausführungen glorifiziert er das oberflächliche Lesen. Denn bei schwierigeren Texten führt diese Art zu lesen nämlich zu fehlerhaft aufgenommenen Inhalten und damit zu Unverständnis.
Dass Reichen da etwas nicht versteht, sieht man auch aus dem Zitat von Meiers (Seite 14): „. dass die Kinder einen Text zwar einwandfrei, d.h. lautrichtig, auch mit angemessener Betonung, vorlesen, dass dies aber auch häufig ohne Sinnverständnis bleibt.“ Gerade wenn ein Text angemessen betont wird, weiß man auch, was man liest.
Reichen geht vom Endzustand des Leseerwerbs aus, der aber mit seiner Methode sofort erreicht wird, wie er behauptet. Für ihn heißt Lesen: „Auf einen Text blicken und im gleichen Moment (was zugleich bedeutet: ohne inneres Vorlesen) verstehen, was er aussagt. Ja, klar, so lese ich auch, aber dahin kam ich schrittweise. Darin sehe ich das Hauptproblem der Methode: Man geht vom Erwachsenen aus, der etwas perfekt beherrscht, und will diese Stufe sofort erreichen. Dabei wird aber vergessen, dass das Kind die Perfektion erst nach und nach entwickelt.
Dass die Kinder am Anfang, das, was sie geschrieben haben, selbst nicht lesen können, das sei normal. Sie lernen es nach und nach und können es nach einer gewissen Zeit perfekt, wird behauptet.
Dem klaren Satz, dass man Lesen nur durch Lesen lernt, widerspricht Reichen auch entschieden. Er fragt, „wie soll jemand lesen, der es noch nicht kann?“ Da zweifle ich langsam an seinem Verstand.
Er vergleicht das Lesen- und Schreibenlernen mit dem Sprechen- und Hörenlernen. Letzteres geht problemlos. Ersteres geschieht in der Schule und funktioniert oft nicht. Ich habe dieses Argument schon oft gehört. Es wird einfach übersehen, dass Lesen und Schreiben Kulturtechniken sind, die nicht von selbst erworben werden können. Reichen glaubt aber, dass das ginge.
Dass in seinem Konzept die Selbststeuerung des Kindes das A und O ist, versteht sich von selbst.
Auf Seite 82 führt er aus: „Würde … der Fibelunterricht funktional zum Lesen führen, dann dürfte es zwei Situationen nicht geben, die es aber trotzdem gibt:
– Erstens dürfte es keine Kinder geben, die zwar einen Fibelunterricht besuchten, aber nicht (oder nur unzureichend) lesen können.
– Zweitens dürfte es keine Kinder geben, die zwar keinen Fibelunterricht besuchten, aber trotzdem sehr gut lesen können.“
Dass man auf eine solche Bauernfängerlogik hereinfallen kann, ist mir unerklärlich.
Rechtschreibung – Ein Kapitel ist überschrieben: „Das Ärgernis Rechtschreibung“. Für Reichen ist die Rechtschreibung tatsächlich ein Ärgernis, das er regelrecht verteufelt, und als „unproduktives Buchstabenwissen bezeichnet, das der Bürokratenmentalität Vorschub leistet.“ Dabei übersieht er, dass derjenige, der den zweiten Schritt vor dem ersten tut, sprich schreibt, ohne es richtig zu können, nie perfekt werden kann. Dazu bedarf es keiner wissenschaftlichen Untersuchungen. Das gilt im Leben, und das müsste eigentlich jeder wissen. Wie naiv Reichen denkt, wird auf Seite 138 deutlich. Er weist nämlich darauf hin, dass früher, als er noch zur Schule ging, gar kein spezieller Rechtschreibunterricht stattgefunden hat. Trotzdem war die Rechtschreibung in Ordnung. Er schließt daraus, „dass offenbar unser Verstand bzw. unser Gehirn diese Regeln außerbewusst kennt und das Schreiben automatisch an diesen Regeln ausrichtet: Wir verfügen impliziert über das entsprechende Wissen und Können.“ Ich weiß, wie das früher war. Er beschreibt das richtig. Aber, dass wir damals die Rechtschreibung quasi automatisch beherrschten, das kam vom vielen Üben. Wir haben in den ersten beiden Klassen viel geschrieben, vor allem auch aus Büchern abgeschrieben. Eigene Texte, bei denen man viel falsch schreiben kann, mussten wir erst in der dritten Klasse erstellen. Deswegen hatten wir die Rechtschreibung intus. Die vielen Rechtschreibregeln, die ich heute meinen Schülern beibringen muss, habe ich nicht in der Schule gelernt. Da brauchten wir kein Regelwerk. Aber: Dieses viele Üben von damals gibt es heute nicht mehr, und die Kinder müssen Geschichten schreiben, obwohl sie weder die Rechtschreibung kennen noch den Stift richtig halten können. Wer zuerst schreiben darf, wie er die Wörter hört, dem muss man eben später ein Regelwerk eintrichtern, damit er richtig schreibt.
Legasthenie – Interessant ist das Kapitel über die Legasthenie. Da gibt es ganze Passagen, wo ich zustimmen kann, denn ich halte Legasthenie auch nicht für eine Krankheit. Aber völlig anderer Meinung bin ich, was das Lernen an sich anbetrifft. Die traditionelle Förderung geht seiner Meinung nach von einer Art Defizittheorie aus. Reichen hält nichts von einem kleinschrittigen Vorgehen. Meine Erfahrung ist da ganz anders. Übereinstimmung gibt es, wo es um die Zuneigung zu den Kindern geht, um Ermunterung, und um Geduld. Ich bin überzeugt davon, dass das sinkende Niveau bei der Rechtschreibung durch die falsche Reihenfolge der Lehre verursacht wird. Es wird geschrieben, obwohl man es nicht kann, mit oder ohne Anlauttabelle. Auch wenn die Reichen-Methode nicht zur Anwendung kommt, die Kinder sollen im ersten Schuljahr schon nach ganz kurzer Zeit eigene Texte verfassen, was sie aber nur können, wenn sie fehlerhaft schreiben und kraxeln dürfen. Da wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht.
Das Letzte – Zum Schluss bringt Reichen auch noch die Geschichte, wie er zu seiner Methode kam. Er behauptet, dass er nach dem ersten Schuljahr nicht lesen konnte. Als er Anfang des zweiten Schuljahres länger erkrankte, sollte er zuhause ein Buch lesen, das in Fraktur gedruckt war. Er hatte eine gute Ausrede, das zu verweigern, denn diese Schriftart kannte er nicht. Eveline, die im selben Haus wohnte, und etwas älter war, meinte, dass das kein Problem sei. Eveline zeigte ihm das an einem Nachmittag, und abends las er ein ganzes Buch!
Rohrbeck, Diana - Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche stärken

Rohrbeck, Diana – Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche stärken – 39 bewährte Tipps bei LRS
Ein nützliches Taschenbuch für Eltern! Es ist leicht zu lesen und die Argumente und Tipps sind überzeugend.
Als ich die Empfehlung (beim Tipp zu „Abschreiben“) gelesen habe, mit dem Finger den Text entlangzufahren, habe ich mich richtig gefreut, denn diese Maßnahme empfehle ich auch, obwohl sie von vielen als Zeichen der Schwäche gesehen wird. Sehr anschaulich beschrieben ist auch die Wichtigkeit der Automatisierung, z.B. um Wörter nicht zu lesen, sondern um sie (blitzschnell) zu erkennen. Ein Kapitel ist dem Lernen mit Karteikarten gewidmet. Mit diesem System bzw. den Wiederholungen lässt sich eine Automatisierung effizient erreichen. Im Kapitel „Körperhaltung“ wurde ich an meine Kindheit erinnert. „Setz dich gerade hin!“, sagte auch meine Großmutter immer zu mir. Heute weiß ich, dass sie recht hatte. Hier wird an wichtige Grundsätze erinnert, die leider oft in Vergessenheit geraten sind. Beim Punkt „Misserfolgsvermeidungsstrategie“ lernt man Frühindikatoren für Probleme kennen, die Eltern oft übersehen. Gut gefallen hat mir auch, dass die Autorin das hohe Lied des Übens singt. Nur wenn etwas durch Üben gesichert gekonnt wird, kann man darauf aufbauen.
Das Buch ist ein kleines Rundumpaket für Eltern, die ihren Kindern helfen oder zumindest mehr vom Thema Lese- und Rechtschreibschwäche erfahren wollen.
Eingangs erläutert die Autorin den Unterschied zwischen Lese-Rechtschreibschwäche und -störung. Ich umgehe dieses Thema, indem ich von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten spreche. Ich fördere meine Schüler individuell, so wie es die Autorin auch empfiehlt, und schaue, wo es bei meinen Schülern hakt. Und danach gestalte ich meine individuelle Förderung mit dem Kind.
Rosebrock – Nix – Rieckmann – Gold – Leseflüssigkeit fördern – Laufleseverfahren
Rosebrock – Nix – Rieckmann – Gold – Leseflüssigkeit fördern – Laufleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe – 2011 Kallmeyer in Verbindung mit Klett – 8. Auflage – ISBN 978-3-7800-1073-5
Wer sich einen Überblick über die verschiedenen Lautleseverfahren verschaffen will, ist mit diesem Buch gut bedient. Es kann auch Lesepaten helfen, ihre Arbeit zielgerichteter auszuführen.
In der Einleitung wird betont und herausgearbeitet, wie wichtig es ist, Leseschwierigkeiten schon früh zu bekämpfen, denn der Rückstand, den Kinder dadurch erleiden, ist in späteren Jahren kaum mehr aufzuholen.
Ich wurde in dem Buch auch an eine Methode erinnert, die meine Lehrer in der Schule praktizierten, das sogenannte Chorlesen. Es ist heute weitgehend verpönt, weil es vermutlich an die Drillpädagogik erinnert, schreiben die Autoren. Aber zur individuellen Leseförderung ist das gemeinsame Lesen von Trainer und Schüler eine gute Möglichkeit, die auch im Buch eingehend erläutert wird.
Wenn Leser noch sehr schwach sind und trotz langsamen Lesens viele Wörter nicht richtig lesen, dann muss zuerst der Korrektheit Priorität eingeräumt werden. Denn gerade schwache Leser neigen dazu, durch schnelles Lesen (ergänzt durch das Raten) ihre schlechte Lesefertigkeit zu überdecken.
Interessante Ausführungen gibt es auch zur Lesbarkeit von Texten, z.B. den Text im Flattersatz mit sehr kurzen Zeilen zu präsentieren, so wie ich es in meinen Übungen oft mache. Es wird auch über die einfache Sprache berichtet und darüber, dass Lehrer mit Texten gleichen Inhalts, aber in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden individuell auf ihre Schüler eingehen können. Meine Meinung dazu ist, dass so etwas nur als vorübergehende Hilfe gedacht sein kann. Ansonsten werden die betroffenen Schüler einfach auf einem niedrigeren Niveau bleiben.
Es gibt noch ein ausführliches Beispiel und Informationen, wie das Verfahren in den Unterricht eingeführt werden kann.
Mit einem Teil mit guten Übungstexten schließt das Buch.
Rudolph, Michael -Wahnsinn Schule - Was sich dringend ändern muss

Michael Rudolph / Susanne Leinemann – Wahnsinn Schule – Was sich dringend ändern muss – Rohwolt Berlin – ISBN 978-3-7371-0094-6
Nachdem ich von meinem Namensvetter schon öfter in Zeitungsartikeln etwas Interessantes gelesen habe, habe ich mir dieses Buch sofort besorgt. Ich kann es nur empfehlen. Es wird aufgezeigt, und zwar an einleuchtenden Beispielen, was im Schulsystem überdacht werden sollte.
Da geht es zuerst um die Grundlagen, also um Lesen, Schreiben und Rechnen. „Was ist 3 mal 9?“, fragt mein Namensvetter seine Schüler, die neu in seine Berliner Sekundarschule kommen (7. Klasse, da in Berlin die Grundschule 6 Klassen hat). Ergebnis: ca. 1/3 weiß das, 1/3 kommt langsam auf das Ergebnis, und 1/3 hat keine Ahnung. Beim Schreiben ermüden die Schüler schon nach wenig Text, stellt er fest. Und ich denke mir, genauso wie in den Schulen, mit denen ich zu tun habe. Und natürlich ist auch die weit verbreitete Leseschwäche ein Handicap in allen Schulfächern.
Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Schulinspektion, deren Forderung lautet: „Anstelle von trägem Wissen, das die Schülerinnen und Schüler nur zur Beantwortung von eng begrenzten und bekannten Aufgabenstellungen nutzen können, soll vernetztes Wissen entwickelt werden, das zur Bewältigung vielfacher Probleme angewendet werden kann.“ „Üben, bis die Basis sitzt“, wie der Autor es in seiner Schule praktiziert, wird als Steinzeitpädagogik abgetan, und die guten Ergebnisse, die das Üben aber bringt, werden einfach ignoriert. „Das Hauptaugenmerk auf Leistung zu setzen, sei einfach zu wenig“, meint der oft zitierte Erziehungswissenschaftler Hans Brügelmann. Auch ich wundere mich seit langem darüber, dass die Ergebnisse der vielen Studien (z.B. Pisa) die Verantwortlichen für die Bildungspolitik ungerührt lassen.
Ein Kapitel ist überschrieben: „Autorität sein, aber nicht autoritär“. Der Autor räumt darin mit der vielfach geforderten „Augenhöhe“ auf, mit der manche glauben, den Schülern begegnen zu müssen. Der Schüler muss als Person respektiert werden. Mit dem Schüler auf Augenhöhe zu sein, „hieße ja, ich durchlebe die Situation zum ersten Mal“.
Sehr schön und motivierend sind die vielen Erfolgsgeschichten von Schülern, die, oft auch im Nachhinein, erkannt haben, dass Disziplin, Durchhaltevermögen und Anstrengung sich lohnen. Ich habe beim Lesen begriffen, warum Lehrer so viel Wert auf Rituale legen. Weil sie nämlich den Schülern Struktur geben, die diese dringend brauchen. Interessant ist, wie in den Schulen des Autors Regelverstöße geahndet werden. Es wird geputzt, Laub gekehrt, Papier aufgesammelt usw. Wer zum Beispiel zu spät kommt, kommt nicht in die Schule rein. Das Tor ist verschlossen. Man muss klingeln, sich im Sekretariat melden und bekommt dann eine Aufgabe bis zum Beginn der nächsten Stunde.
Ich fand das Buch kurzweilig und informativ, und ich finde, es sollte von allen, die mit Schule zu tun haben, gelesen werden. Man findet vielleicht Bestätigung der eigenen Erfahrung oder wird nachdenklich, ob die moderne Pädagogik mit der Methode des selbstbestimmten Lernens wirklich immer und für alle passt.
Ein Zitat zum Schluss (Seite 205): „Womöglich sollte die moderne Pädagogik darüber nachdenken, ob Übung nicht viel wichtiger ist als eine riesige Stofffülle. Wäre es nicht angebracht, die wesentlichen Dinge nachhaltig zu vermitteln, damit sie wirklich sitzen, als mit immer neuen Kompetenzen, immer neuen Oberthemen, immer neuen Schulfächern, immer neuer Architektur zu kommen? Denn alles, was neu hinzukommt, führt dazu, dass für die Basis weniger Zeit bleibt. Und diese Basis – Lesen, Schreiben, Rechnen – ist bekanntermaßen häufig viel zu fragil.“
Dazu passend: Aktuell stellt eine Sonderauswertung der PISA-Studie 2018 fest, dass mehr als die Hälfte der 15 Jahre alten Schüler Probleme hat, Meinungen und Fakten auseinanderzuhalten. Die Schlussfolgerung ist klar: Ein Fach Medienkompetenz muss her. Aber ohne ausreichende Lesefertigkeit hat es wenig Sinn, Medienkompetenz zu lehren.
Scheerer-Neumann, Gerheid - Schreiben lernen nach Gehör?
Gerheid Scheerer-Neumann – Schreiben lernen nach Gehör? – Freies Schreiben kontra Rechtsschreiben von Anfang an – Klett | Kallmeyer – ISBN 978-3-7727-1260-9

„bildung kontrovers“
Diesem Hinweis auf dem Cover wird das Buch gerecht!
Ich habe mir das Buch zur Vorbereitung eines Artikels über die Schreibtabelle gekauft. Das Thema wird im Buch ausführlich erläutert. Man erfährt auch viel über die verschiedenen Verfahren, wie zum Beispiel zum Spracherfahrungsansatz, zu Lesen durch Schreiben und zu verschiedenen Fibellehrgängen. Auch wenn ich zur Schreibtabelle nichts Neues erfahren habe und meine Meinung bestätigt wurde, ich habe den Kauf nicht bereut.
Ob es bei einer Methode eine bessere Rechtschreibung gibt, das wurde, wie die Autorin beschreibt, in vielen Studien untersucht. Man gewinnt aber den Eindruck, dass man nichts Genaues daraus schließen kann. Ein Vergleich mit der Methode, die es zu meiner Schulzeit gab, ist leider nicht so ohne weiteres möglich. Aber die Untersuchung von Steinig mit der Anzahl von Fehlern pro 100 Wörtern in verschiedenen Jahren zeigt deutlich, dass früher besser geschrieben wurde. In einer anderen Studie wird das Ergebnis wie folgt zusammengefasst: „Fast die Hälfte der Probanden von 1995 wäre 1968 als rechtschreibschwach eingestuft worden. Die wesentlichen Änderungen in der Lehre gab es ab Ende der Achtzigerjahre. Welchen Anteil am Rückgang der Rechtschreibkompetenz die vernachlässigte Handschrift hat, das wäre interessant. Auf die Bedeutung der Handschrift für die Rechtschreibung geht die Autorin nicht ein. Dabei ist das Erlernen und Anwenden einer verbundenen Schrift von Anfang an genau wegen des freien Schreibens von Anfang an geopfert worden.
Eine falsche Rechtschreibung, die zu Anfang des Schreiblernprozesses nicht korrigiert wird, prägt sich nicht ein, heißt es im Buch. Ich glaube auch, dass das stimmt. Meine Schüler mit ganz schwacher Rechtschreibung haben sich keine falschen Routinen eingeprägt. Sie haben Chaos im Kopf, weil sie die Rechtschreibung nicht systematisch gelernt haben. Die im Fibellehrgang vorgegebene Struktur wurde zu wenig geübt und durch das Korrigieren der eigenen, freien Texte zerstört. Beispiel aus dem Buch, Seite 52:
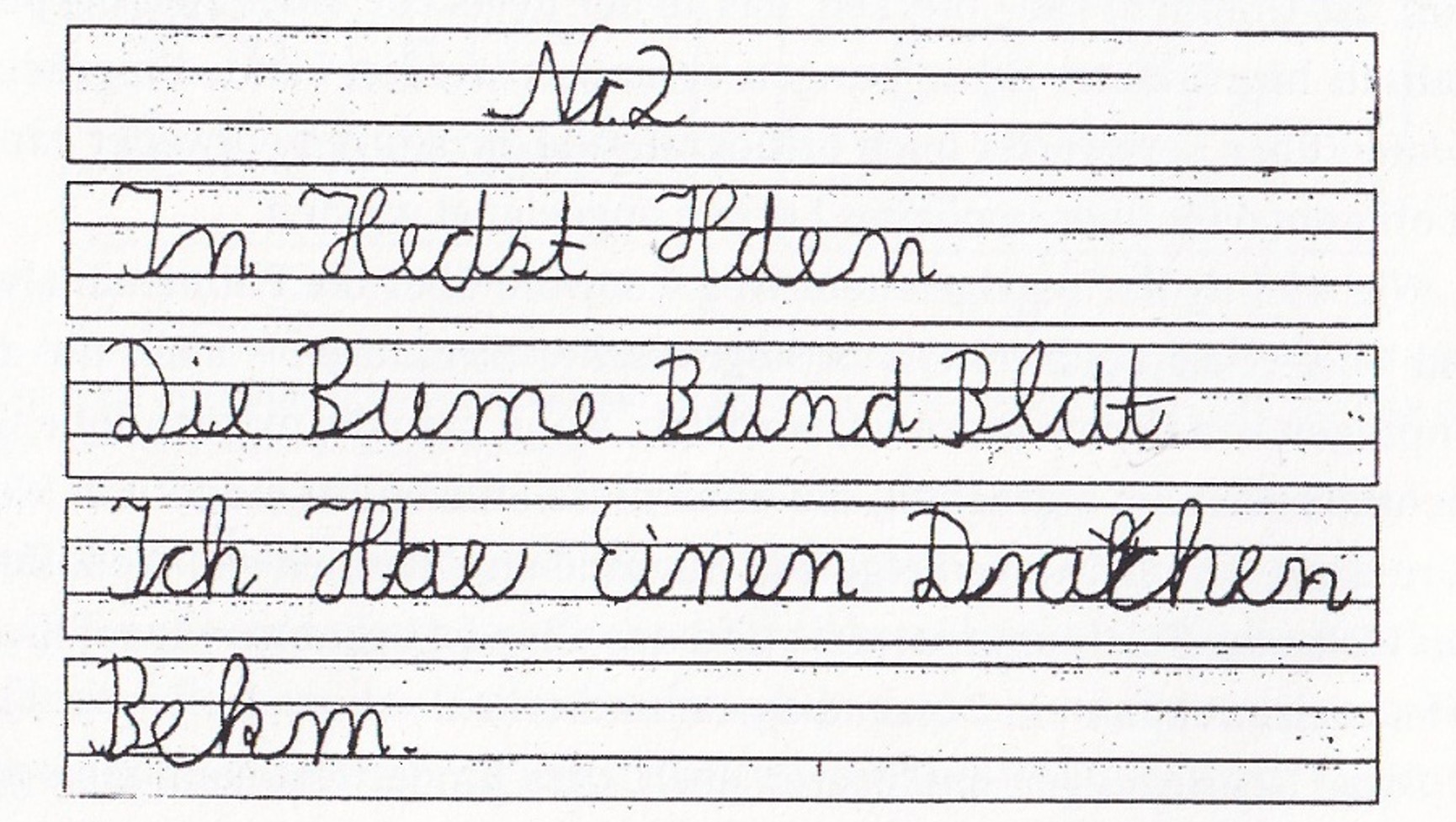
Text: Im Herbst haben die Bäume bunte Blätter. Wenn man jeden Fehler korrigiert, wird das für das Kind verwirrend. Selbst wenn man zu jedem Fehler eine Erklärung abgibt und weitere Beispiele bringt: Die Systematik geht verloren. Für mich ist das Beispiel zudem ein Beweis für den Unsinn des freien Drauflosschreibens!
Was auch deutlich herauskommt: Die heutigen Fibellehrgänge kann man nicht mit der Methode gleichsetzen, die es zu meiner Schulzeit gab. Bei uns wurden Lesen und Schreiben getrennt gelehrt. Lesen konnten wir schon zu Weihnachten des ersten Schuljahres. Aber eigene Texte waren uns erst viel später als heute möglich. Wir haben nicht mit der Druckschrift begonnen. Es dauert halt, bis man eine verbundene Handschrift eingeübt hat. Aber dabei hat man so viele Wörter richtig abschreiben müssen, dass sich die Rechtschreibung praktisch von selbst eingeprägt hat. Bei heutigen Fibellehrgängen zieht sich das Lesenlernen aller Laute fast über das ganze erste Schuljahr hin. Das wird im Buch sehr gut dargestellt. Persönliche Anmerkung: Da wird viel Zeit verschenkt. Und vor allem: Zu Anfang gibt es nur primitive Texte. Da ist von „Fibel-Dadaismus“ die Rede.
Gefreut habe ich mich über die kritischen Anmerkungen zu den in Schulbüchern verwendeten Silben, insbesondere zur Trennung der Doppelkonsonanten, die aber nur einmal zu lesen sind. Die Bedeutung der Silbe wird aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Einen Minuspunkt gibt es für die Schriftgröße und -farbe (teilweise hellgrau), die mir das Lesen zur Qual machte.
Schönweiss, Prof. Dr. Friedrich, Herausgeber – Handbuch zur Rechtschreibförderung

Schönweiss, Prof. Dr. Friedrich, Herausgeber – Handbuch zur Rechtschreibförderung Prof. Dr. Friedrich Schönweiss, Herausgeber – Handbuch zur Rechtschreibförderung – Lernserver Münster – ISBN 978-3-940876-00-3
Die Zielgruppe sind Lehrer, Lerntherapeuten und Eltern.
Im Kapitel I erhält man einen Überblick über die Lernserver-Förderdiagnostik für einzelne Schüler oder ganze Klassen. Kapitel II gibt einen Einblick in die Stoßrichtung der pädagogisch-didaktischen Methodik. Kapitel III enthält viel zum Thema Rechtschreibung. Schon dieses Kapitels wegen lohnt sich der Kauf. Im kurzen Kapitel IV wird dann eine Art Ausblick auf neue Möglichkeiten der Förderung versucht.
Gleich am Anfang (Seite 6) stolpere ich über eine Anmerkung: „Ausgerechnet zu einer Zeit, in der das Bildungswesen nachdrücklich auf Leitbilder wie Selbstständigkeit und Kreativität, Individualität und Persönlichkeit verpflichtet wird, empfinden viele Menschen den Anspruch von Bildung nunmehr als Belästigung oder gar als Bedrohung. Trotz allgemeiner Schulpflicht gedeiht der Analphabetismus; normal begabte Kinder versagen plötzlich in einzelnen Fächern oder ziehen sich ganz aus dem Bildungsprozess zurück; Mütter fühlen sich als ´Hilfslehrer der Nation´ hoffnungslos überfordert; Lehrer sehen in ihrer Tätigkeit keinen Sinn mehr und ´brennen aus´. Was ist geschehen?“ Das Zitat stammt aus dem Jahr 2000. Inzwischen sieht es ja noch schlimmer aus. Für mich steht das Leitbild der Selbstständigkeit, Kreativität, Individualität und Persönlichkeit in der Bildung in einem engen Wirkungszusammenhang mit den genannten Problemen. Man will „die Kinder als kleine Persönlichkeiten ´ganzheitlich´ ins Spiel bringen.“ Mit den diagnostischen Hilfsmitteln, die zur Verfügung gestellt werden, will man, dass Eltern, Lehrer und Therapeuten komfortabel und passgenau darauf zugreifen können. Die Fördermaterialien, die ich mir noch anschauen will, sollen abgestimmt auf den ganz konkreten Unterstützungsbedarf des Kindes, einer Klasse oder einer kompletten Stufe sein. Von einer kompetenten Nutzerin habe ich gehört, dass diese Unterlagen sehr gut sein sollen.
Gut finde ich die Aussage zu LRS bzw. Legasthenie. Das Attest für die Legasthenie wird als „Auftakt der Stigmatisierung“ angesehen.
Neben dem Regelbereich, den ich bisher immer als einzigen Inhalt der Rechtschreibförderung angesehen habe, geht man hier auch auf den Wahrnehmungsbereich ein und bezeichnet das als grundlegenden Bereich. Da habe ich dazugelernt. Die Ausführungen z.B. zur Betonung und zum „guten Sprechen“ sind sehr interessant.
Die Förderung der Schreibschrift wird auch hier außen vor gelassen. Für mich, als jemanden, der eigene Texte erst in der dritten Klasse schreiben musste, ist nicht einzusehen, warum man, nur um die Kreativität zu fördern, die Kinder schreiben lässt, wenn sie noch nicht die nötigen Voraussetzungen dafür erworben haben.
Hoffnung macht in diesem Zusammenhang, dass man das grundlegende Problem erkennt: „Gerade Letzteres (Anm.: die Effektivität bzw. Begrenztheit mancher Unterrichtsmethoden) tritt leider immer mehr zutage und unterstreicht, wie notwendig eine grundlegende Revision etlicher grundschuldidaktischer Ansätze ist.“ Nur, wann kommt diese Revision?
Unter „Allgemeines zum Regelbereich“ findet sich folgende Passage: „Diese Hilfestellung (Anm. zur Rechtschreibung) gibt es in Form von Regeln, deren Aneignung weniger Zeit und Mühe beansprucht, als die Schreibung aller Wörter der deutschen Sprache auswendig zu lernen, ganz abgesehen davon, dass sprachliche Kompetenz nicht damit zu verwechseln ist, den eigenen Kopf als tumbes Speichermedium zu missbrauchen. Mit dem Wissen und der Anwendung dieser Regeln kann ein großer Teil der Wörter, der Kernbereich (Anm.: Das ist genau der Bereich, den wir korrekt schreiben konnten, und zwar schon, bevor wir eigene Texte schreiben mussten.) korrekt verschriftet werden. Der für ein souveränes Umgehen mit der Schriftsprache erforderliche Automatismus stellt sich übrigens dann meist recht schnell ein.“ Und darin liegt nach meiner Meinung ein Problem! Es wird zu wenig geschrieben. Und deshalb stellt sich diese Automatisierung halt oft nicht ein. Und auch beim Lernserver gibt es, so wie ich es bisher gelesen habe, nur Lückentexte. Das ist jetzt keine Kritik, ich mache es auch so, weil die Übungen sonst einfach zu lange dauern. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Die Autoren geben auch Argumentationshilfe, um den Kindern zu erklären, warum Rechtschreibung wichtig ist. Gut finde ich den Vorschlag, dass sich die Kinder die Regeln auch gegenseitig erklären sollen. Und es wird auch empfohlen, die Kinder mit den Arbeitsblättern nicht allein zu lassen. In diesem Zusammenhang bekommen auch Eltern viele nützliche Tipps. Es werden auch – in verständlicher Kürze – die Rechtschreibphänomene abgehandelt. Mir ist nur aufgefallen, dass man beim Eszett voraussetzt, dass man es hört. Also ich bin weder in der Lage, es zu hören, wobei das Eszett in Süddeutschland sowieso kaum gesprochen wird, noch es zu sprechen.
Zitat zur Groß- und Kleinschreibung (Seite 48): „Das Problem der Großschreibung ist weder dem Wahrnehmungs- noch dem Regelbereich zuzuordnen, sondern dem grammatikalischen Bereich.“ Das bedeutet, dass bei Legasthenie die Rechtschreibfehler trotz Notenschutz gewertet werden. Die Abgrenzung zum Wahrnehmungsbereich ist ja noch einsichtig, aber zum Regelbereich? Aber das hat ja nicht der Lernserver entschieden, sondern so ist es halt.
Das Kapitel II – Kompendium zur Rechtschreibförderung habe ich gerne gelesen. Es ist ein guter Überblick mit den notwendigen Details und Beispielen zum Verstehen.
Schönweiss, Petra - Finde das wichtige Wort

Petra Schönweiss – Finde das wichtige Wort – Eine alternative Hinführung zur Großschreibung: Das satzbezogene Konzept – Klasse 2/3 Lernserver – ISBN 978-3-940876-16-4
Eigentlich gehört dieses Buch zum Menüpunkt Übungsmaterial. Die Autorin beschreibt die Methode als Alternative zur herkömmlichen Lehre in den Grundschulen. Da ich diese Methode aber nicht empfehlen möchte, bespreche ich das Buch hier, unter Fachliteratur.
In der Einführung werden zwei Methoden für die Vermittlung der Großschreibung dargestellt: die wortartenbezogene Großschreibung und die satzbezogene Großschreibung. Letztere kannte ich nur flüchtig, im Buch wird die Methode verständlich beschrieben, und es gibt ausreichend Übungsmaterial.
Die beschriebene Kritik an der vorherrschenden Lehre in den Grundschulen teile ich. Ich ärgere mich immer, wenn ich in Klassenzimmern Plakate sehe, auf denen zu Nomen z.B. steht, dass man sie anfassen oder sehen kann und dass ein Artikel dabei ist.
„Es stimmt eigentlich nicht, dass nur Substantive (meist als ´Nomen´ bezeichnet) von der Großschreibung betroffen sind. Vielmehr können bzw. müssen alle Wortarten großgeschrieben werden, wenn sie eine bestimmte Funktion im Satz innehaben (man spricht dann gemeinhin von ´Substantivierungen)´. Dieses Zitat zeigt ein Problem auf, das tatsächlich viele Schüler haben. Deswegen sehe ich die Lehre der Großschreibung in den Grundschulen auch kritisch. Nomen sind vor allem Namen. Dass „gehen“ laut Duden nur ein Verb ist, ist zwar richtig, aber wenn ich das, was wir mit den Beinen im Normalfall tun, bezeichne, dann ist es eine Bezeichnung, also ein Nomen. Den Begriff der Substantivierung brauche ich dafür eigentlich nicht.
Ich lehre deshalb: Nomen sind Namen, und Namen schreibt man groß. Die Autorin beschreibt wegen der Schwäche der Lehre in den Grundschulen die satzbezogene Großschreibung als Alternative. „Sie (Anm.: die satzbezogene Großschreibung) kennzeichnet die syntaktische Funktion eines Wortes, sie ist Mittel zur Strukturierung eines Textes, sie hebt ´wichtige´ Wörter hervor und erleichtert somit dem Leser, den Sinn des Geschriebenen schnell zu erfassen.“ Letztlich geht es darum, dass man das wichtige Wort links mit Attributen erweitern kann. (Attribute rechts könnten sich auch auf Pronomen beziehen.) Die durch die jüngste Rechtschreibreform bedingten Ausnahmen muss man lernen, heißt es im Buch. Ich denke, dass damit „im Voraus“ und ähnliche Substantivierungen von Dudens Gnaden gemeint sind. Da passt meine Methode „Nomen sind Namen“ leider auch nicht mehr.
Interessant ist der kurze Blick in die Geschichte. Es wird schön beschrieben, wie es zur Großschreibung kam, nämlich um Wichtiges hervorzuheben.
Wer sich mit der Methode beschäftigen will, für den ist das Buch eine gute Einführung. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es – vom theoretischen Überbau abgesehen – darauf hinausläuft, dass ich vor jedem Nomen, hier als Stufenwörter bezeichnet, Einfüllwörter einfügen kann, die eine bestimmte Endung, bedingt durch die Beugung haben: -e, -en, -er, -es oder -em.
Beispiel:
„Der brave Hokus
hilft
seinem guten Freund
schrecklich gern
beim lästigen Abspülen.“
In der vierten Zeile könnte „gern“ mit einem Stufenwort verwechselt werden. Aber das Einfüllwort „schrecklich“ hat nicht die passenden Endungen. Da bleib ich lieber bei „Nomen sind Namen!“ Und bringe meinen Schülern lieber bei, dass „gern“ kein Name ist, sondern ein Adverb, das Näheres zum Verb helfen sagt.
Schuhmacher, Dr. med. Heike – Fehler muss man sehen!

Dr. med. Heike Schuhmacher – Fehler muss man sehen! LRS und visuelle Wahrnehmungsstörungen erkennen und behandeln – tredition GmbH, Hamburg – ISBN 978-2-7323-3693-7
Das Buch behandelt Hör- und Sehprobleme als Ursache von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Man erfährt viel über die zugrunde liegenden Funktionen im Gehirn. Teilweise werden diese Funktionen sehr technisch dargestellt, z.B. wenn von einem Rechtschreibscanner im Gehirn gesprochen wird.
Gleich zu Beginn wird aber eine gute Nachricht verkündet: Die visuellen Grundfunktionen unseres Gehirns können durch Training verbessert werden.
Das Buch enthält ein paar anschauliche Praxisbeispiele und nützliche Checklisten. Die Beispiele erinnern mich an meine eigenen Erfahrungen mit Schulkindern, die ich fördere.
Der von der WHO definierte LRS-Begriff sieht vor, dass die Legasthenie nicht durch eine Seh- und Hörbehinderung verursacht sein darf. Die Autorin sagt dazu, dass die im Buch beschriebenen auditiven Wahrnehmungsstörungen nicht darunterfallen, denn diese waren zum Zeitpunkt der WHO-Definition noch wenig bekannt. Gemeint war damals, dass die Kinder eine normale Sehschärfe haben und nicht schwerhörig sind.
Die auditiven Wahrnehmungsschwierigkeiten werden ausführlich beschrieben.
Im Kapitel Neuroplastizität wird ausgeführt, dass das Gehirn lebenslang entwickelt werden kann. Das heißt auch, dass die Diagnose Legasthenie nur eine Momentaufnahme ist. Und das ist eine wichtige Botschaft des Buches.
Ich möchte noch ein paar persönliche Anmerkungen machen:
Mir kommt bei Lesen des Buches immer wieder in den Sinn, dass ein großer Teil der Probleme darauf zurückzuführen ist, dass die Kinder Wörter nach Gehör richtig schreiben sollen und dass zuerst die Druck- und dann die Schreibschrift gelehrt wird. Auf die Handschrift selbst, die ungeübt in vielen Fällen die Ursache des Problems ist, geht die Autorin nicht ein.
Das Elend der heutigen Pädagogik kommt m.E. in folgender Passage zum Ausdruck:
„Visueller Rechtschreibscanner vs. jahrelanges Rechtschreibregeltraining
Sie wissen selbst, wie lange Sie brauchen, um aus den Vorschlägen Ihres Rechtschreibprogramms die passende Schreibweise für ein Wort herauszusuchen. In dieser Lage sind auch die Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche, die durch jahrelanges Regeltraining absolut jede Rechtschreibregel auswendig wissen und trotzdem in jedem Diktat unzählige Fehler machen. Die Geschwindigkeit, mit der beim Diktieren gesprochen und geschrieben wird, ist viel zu hoch, um gleichzeitig über Rechtschreibregeln nachzudenken. Das schafft kein Gehirn der Welt.“ Den letzten Satz halte ich für überzogen, denn die Autorin sagt nichts zur Handschrift, die flüssig sein sollte, die das aber bei Kindern mit Rechtschreibschwierigkeiten meist nicht ist. Es heißt ein paar Absätze weiter: „Der visuelle Rechtschreibscanner macht alle Arbeitsvorgänge, die mit Rechtschreibung zu tun haben, wirklich einfach und erfordert so gut wie keine Energie.“ Auch da fehlt etwas! Dieser Rechtschreibscanner muss aufgebaut werden, und zwar nicht nur durch das Anschauen der Wörter beim Lesen eines Textes, sondern man muss die Wörter schreiben, schreiben und nochmals schreiben. So habe ich es gelernt, und zwar die deutschen Wörter und die englischen.
Gerd Schulte-Körne - Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft

Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft
Herausgegeben von Gerd Schulte-Körne in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.
Ein dicker Band mit Beiträgen vieler Autoren. Die Beiträge umfassen die Diagnostik, die Förderung, die Hyperaktivität, die Ursachen der Lese- und Rechtschreibschwäche, rechtliche Aspekte, die Diagnostik bei der Rechenschwäche, die Förderung bei der Rechenschwäche.
Ich habe einige Kapitel durchgearbeitet und schlage gelegentlich mal im Buch nach, das eher für Fachleute als für Lesepaten geschrieben wurde.
Schulze Brüning/Clauss - Wer nicht schreibt, bleibt dumm ♥

Maria-Anna Schulze Brüning, Stephan Clauss – Wer nicht schreibt, bleibt dumm – Warum unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen – Piper Verlag 2017
Wer sich wundert, warum so viele Schüler heute eine unsichere bzw. schlechte Handschrift haben, der weiß warum, wenn er dieses Buch gelesen hat. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Handschrift, verständlich argumentiert und mit guten Beispielen belegt. Als Lese- und Rechtschreibtrainer spricht mir die Autorin aus der Seele. Es wird deutlich, dass es nicht nur um ein ästhetisches Problem geht. „Es geht um ein fehlendes Fundament des Lernens.“ Wer wissen will, warum die Handschrift heute so gering geschätzt wird, der erfährt es hier. Es ist die Reformpädagogik, die meint, es den Schülern durch Vereinfachen immer leichter zu machen, um dadurch schneller Ergebnisse zu erzielen. Übersehen wird dabei, dass man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun sollte. Wer mit der Druckschrift beginnt, wird kaum eine eigene Handschrift entwickeln, wenn die Druckschrift als Erstschrift bereits automatisiert wurde. Es ist erschreckend, zu sehen, wie mit wissenschaftlichen Begründungen elementare Fehler gemacht wurden, die alleine mit gesundem Menschenverstand erkannt werden können, die von der Schuladministration aber blind übernommen werden, weil sie Einsparungen versprechen. Kein Wunder, dass Jürgen Reichen in diesem Zusammenhang mehrfach zitiert wird. Wer am Anfang des Bildungsprozesses glaubt, den zweiten Schritt vor dem ersten machen zu können, wie z.B. Jürgen Reichen beim Schriftspracherwerb, der schadet den Kindern. Die Autorin entzaubert z.B. die Auffassung von Burkhardt Spinnen, der die Handschrift mit einem Pferdewagen in der rush hour vergleicht, wie folgt: „Die Handschrift spielt in unserer alltäglichen Kommunikation … kaum noch eine Rolle. Das ist unbestritten. Und niemand will handgeschriebene Briefe wieder an die Stelle von E-Mails … setzen. Eine ganz andere Frage jedoch lautet: Welche Rolle spielt die Handschrift im Schriftspracherwerb des Kindes? Um im Bild des Pferdewagens zu bleiben: Es hat seine guten Gründe, dass Kinder sich noch nicht selbst auf der Straße bewegen und ein Auto lenken, sondern eher im Tempo eines Pferdewagens unterwegs sind – mit dem Roller, dem Fahrrad, mit Inlinern. Und dass sie zuerst Laufen lernen, bevor sie auf ein Bobbycar steigen.“
„Die Handschrift ist das Werkzeug der Schule.“ Dieser Satz zeigt, worauf es ankommt. Jeder Handwerksmeister achtet darauf, dass er gutes Werkzeug hat und dass seine Gesellen im Gebrauch dieser Werkzeuge geübt sind. Die Reformpädagogik meint, in der Schule gelte das nicht. „Das systematische Üben ist aus der Mode gekommen“, stellt die Autorin fest, der Handschrifterwerb soll quasi nebenher erfolgen. Wenn es lange genug egal ist, wie man schreibt, und eine Art Lautschrift ausreicht, kann das nicht ohne Folgen bleiben. Und die zeigen sich u.a. in der Rechtschreibleistung. Zitiert wird dazu eine Studie, die zeigt, dass 1972 im Schnitt bei 100 Wörtern 7 Fehler gemacht wurden, im Jahr 2012 aber schon 17. Bei mir nährt das den Verdacht, den ich in meinen Blogbeiträgen schon früher geäußert habe, dass die Rechtschreibstörung hausgemacht ist. Nicht das Kind kann etwas dafür, die Lehre ist die Verursacherin.
Wunderbar widerlegt wird auf Seite 135 die Annahme, dass man sich das Erlernen einer schönen Schreibschrift ersparen könne, denn als Erwachsener hat man viele Buchstaben verändert und verbindet nur einige. „Die Handschrift Erwachsener ist die individuelle Interpretation einer Norm durch lange Praxis.“ Die individuelle Handschrift eines Erwachsenen hat sich über lange Zeit entwickelt. Wer meint, Kinder schmieren und Erwachsene tun das wieder, und deshalb könnte man sich die Schreibübungen sparen, irrt gewaltig. Eigentlich müsste jeder wissen: Der Erwachsene „schmiert“ schnell und vor allem flüssig. Das Kind kritzelt langsam und mühsam.
Die Autorin räumt auch mit der oft beschworenen Selbstorganisation des Kindes beim Lernen auf. „Kinder brauchen einen Lehrer, strukturierte Anleitung und sehr viel Übung. Wer glaubt, das ersparen zu können, riskiert Verluste in der Substanz.“ Und diesen Verlust sehen wir täglich! Mein Fazit: Ein interessantes, kurzweiliges und verständliches Buch, das nicht nur die Probleme benennt, sondern auch sagt, was getan werden müsste. Gefallen haben mir auch die Beispiele, die zeigen, dass man sogar in weiterführenden Schulen seine Handschrift noch verbessern kann.
Diana Selig – Die gehirngerechte Vokabelformel

Diana Selig – Die gehirngerechte Vokabelformel
Mit Englisch-Vokabeln wird bestimmt in vielen Familien gekämpft. Manchmal wird der Kampf verloren. Wie kann er gewonnen werden, oder noch besser: Wie kann man Vokabeln lernen ohne Kampf? Genau darum geht es im Buch meiner Netzwerkkollegin Diana Selig.
Es gibt 77 Tipps zum Vokabellernen. Gestartet wird die Auswahl über eine Checkliste mit fiktiven Feststellungen. Wenn der Punkt auf das eigene Kind zutrifft, kann man zu den mit Nummern versehenen passenden Tipps gehen. Und diese Tipps sind Handlungsanleitungen, die gut umzusetzen sind. Da spricht viel Erfahrung zum Leser. Deswegen werden die Tipps auch Experiment genannt. Also ausprobieren, was passt!
Einen Tipp möchte ich erwähnen, weil mich der an meine Schulzeit erinnert: Experiment 4 – Sei voraus: Die Vorlern-Methode! Ich habe das als Schüler oft gemacht, weil ich dann im Unterricht sehr gut mitgekommen bin.
Vorweg gibt es sehr anschauliche Erläuterungen zum Lernen. Wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert, kann man gezielter üben.
Wie man Englisch lernt, wenn eine LRS vorliegt, das wird im Buch auch behandelt.
Ebenso der Einsatz von Audiodateien.
Ich habe in dem Buch meine Englischkenntnisse auffrischen können und einige Erklärungen gelesen, die ich als Kind in der Schule auch gut hätte brauchen können. Zum Beispiel die Einteilung der unregelmäßigen Verben in eine Verbgalerie. Das ist eine gute Merkhilfe, zum Beispiel die Hühnerverben, die mit put, put, put beginnen, dann kommen weitere mit gleicher Struktur: bet, bet, bet; let, let, let; set, set, set. Lustig finde ich die Ochsenfroschverben: bring, brought, brought; buy, bought, bought usw. Da kommt einem unwillkürlich ein quakender Ochsenfrosch in den Sinn. Genial! Diese Einteilung der unregelmäßigen Verben kannte ich bisher nicht.
Also, wer für sein Kind eine Anleitung sucht, wie man mit Vokabeln nicht kämpfen, sondern sie einfach locker und ohne Qual lernen kann, der ist mit diesem Buch gut bedient.
Mit hat es viel Freude gemacht, dieses Buch zu lesen.
Eine sehr schöne mündliche Rezension in einem Video gibt es von meiner Netzwerkkollegin Nicole Fischer – Lernovia Neues Lernen.
Katja Siekmann - Individuelle Diagnose und Förderung bei Rechtschreibschwierigkeiten
Katja Siekmann – Individuelle Diagnose und Förderung bei Rechtschreibschwierigkeiten – Lehrerbücherei GRUNDSCHULE – 2013 Cornelsen Schulverlag Berlin – ISBN 978-3-589-03921-0
Frau Siekmann kommt, das merkt man gleich auf den ersten Seiten, aus der Schule von Prof. Thomé. Das macht sie schon mal sympathisch.
Dass 90 Prozent der Grapheme in deutschen Texten Basisgrapheme sind, also so verschriftet wie gesprochen werden, kenne ich aus den Büchern von Prof. Thomé. Die 10 Prozent Orthographeme scheinen da nicht so problematisch zu sein. An einer Stelle im Buch, auf Seite 32, wird aber deutlich, warum die Rechtschreibung in Deutschland so leidet: Die Prinzipien von Comenius „vom Einfachen zum Schwierigen“ und „vom Häufigen zum Seltenen“ werden im Unterricht nicht eingehalten. Können sie auch nicht, füge ich hinzu! Solange in den Schulen von Anfang an frei drauflosgeschrieben werden kann, ja sogar muss, ist es nicht möglich, systematisch vorzugehen.
Falschschreibungen ließ man lange Zeit durchgehen, bis man merkte, dass sich die Rechtschreibleistungen dauerhaft verschlechterten. Jetzt soll seit ein paar Jahren wieder korrigiert werden, was die Sache aber noch schlimmer macht. Denn es geht dabei jede Systematik, die auch von Frau Siekmann eingefordert wird, verloren. Die Korrekturen können bei einer großen Fehlerzahl nur verwirren.
Eine andere Hauptursache für den Niedergang der Rechtschreibung zeigen die Schreibbeispiele im Buch. Sie bringen das Elend unserer Lehre auf den Punkt. Die Schrift ist teilweise kaum lesbar. Es müsste wieder mehr auf die Handschrift Wert gelegt werden. Wenn die Handschrift Mühe macht, muss sich das Kind darauf konzentrieren und kann nicht an das Ableiten von Regeln denken.
Die Autorin beschreibt sehr schön, worauf es bei der heutigen Lehre ankommt. Mich stört allerdings, dass sie mit dieser Lehre nicht deutlicher ins Gericht geht.
Während für die Diagnose gute Beispiele vorhanden sind, kommt die im Titel genannte Förderung zu kurz.
Eine Passage will ich noch aufgreifen, und zwar die Vokale in unserer Sprache. Ich weiß, welche Schwierigkeiten meine Schüler damit haben. Frau Siekmann berichtet auf Seite 12, dass auch angehende Lehrer ziemlich unsicher sind, wenn sie nach der Zahl der Vokale gefragt werden. Bei den Studenten dürfte es sich um Gymnasiasten handeln. Schöner kann man nicht dokumentieren, wie wenig Sinn es hat, folgende Forderung (Seite 11) aufzustellen: „Schüler müssen somit frühzeitig sprachanalytische Fähigkeiten entwickeln, die zum einen zur Analyse der gesprochenen Sprache, zum anderen zur Erschließung weiterer Prinzipien der Orthographie befähigen.“ Das dürfte nicht nur bei den oben erwähnten Lehramtsstudenten nicht gelungen sein.
Ich habe die meisten Rechtschreibregeln erst gelernt, als ich im Ruhestand mit der Rechtschreibförderung begann. Warum: Weil wir induktiv gelernt haben, durch Abschreiben und Wiederholen. „Sprachanalytische Fähigkeiten“ haben wir für die Rechtschreibung nicht gebraucht.
Spitzer, Manfred - Machen uns Computer dumm?
Spitzer, Manfred – Machen uns Computer dumm?
Machen uns Computer wirklich dumm?
Über das Buch von Professor Manfred Spitzer habe ich bereits etliche Besprechungen gelesen, die kaum ein gutes Haar an den Ausführungen des Autors lassen. Ich habe diese Beiträge alle wohlwollend gelesen, schließlich arbeite ich sehr viel mit dem Computer und nutze ihn ziemlich stark. Und ich denke, dass er mich effizienter und keineswegs dümmer macht, als ich vielleicht schon bin. Da ich den Computer auch zum Verbessern der Lesekompetenz meiner Schüler einsetze und damit gute Fortschritte erziele, ging ich besonders kritisch an diese Lektüre heran.
Es ist bei Professor Spitzer und bei seinen Kritikern oft von Medienkompetenz die Rede. Das Wort Kompetenz bedeutet bekanntlich so viel wie Zuständigkeit, Befugnis oder die Fähigkeit bzw. Souveränität auf einem bestimmten Gebiet. Bei der sogenannten Medienkompetenz geht es in der Diskussion wohl eher um die letztgenannte Interpretation, den souveränen Umgang mit Medien. Was wird hier unter Medien verstanden? Der Computer kann nicht gemeint sein, der ist Hardware und nur Mittel zum Zweck. Mit folgender Passage bringt Professor Spitzer das Problem auf den Punkt: „Gewiss, man kann am PC Vokabeln lernen, denn er ist viel geduldiger als ein Mensch. Das Dumme ist nur: Kaum ein Zwölfjähriger verwendet den Computer dafür. Stattdessen wird geballert und anderer verdummender und aggressionsfördernder Unfug angestellt.“ Mir fällt da ein, wie zum 10. Geburtstag meiner Tochter ein Onkel als Geburtstagsgeschenk einen tollen Fernseher für ihr Kinderzimmer mitbrachte. Den nahm er wieder mit nach Hause, meine Tochter hat das schneller eingesehen und akzeptiert als der Onkel damals. Und so hätte ich das heute mit einer Playstation auch gemacht. Möglicherweise hätte ich die Playstation aber auch immer zusammen mit der Tochter benutzt bzw. den Gebrauch strikt reglementiert. Dazu hätte ich die vielen wissenschaftlichen Studien nicht gebraucht, die Professor Spitzer zitiert. Aber wirklich schlimm finde ich, dass ein Kulturstaatsminister sich für eine Laudatio auf ein Killerspiel hergibt und damit vielen Eltern völlig falsche Signale gibt. Da fehlt es an Medienkompetenz, und zwar erheblich.
Ich finde das Buch lesenswert. Es macht deutlich, dass wir uns als Erwachsene um Medienkompetenz kümmern müssen, um unsere Kinder oder Schutzbefohlenen richtig zu leiten. Aber was man unter Medienkompetenz genau versteht, darüber wird wohl noch mehr gestritten werden. Der Computer kann als Werkzeug eingesetzt werden, für wen und was auch immer. Da kann er Nutzen bringen. Wenn er zur Unterhaltung eingesetzt wird, kommt es auf den Inhalt und die Dosierung an – so wie sonst im Leben auch. Kinder brauchen Anleitung und Anerkennung. Schlimm, wenn sie sich die Anerkennung in Medien oder gar von einem Killerprogramm holen müssen.
Manfred Spitzer, Digitale Demenz, 2012 Droemer Verlag, ISBN 978-3-426-27603-7
Steinig, Wolfgang – Grundschulkulturen - Pädagogik – Didaktik – Politik
Wolfgang Steinig – Grundschulkulturen – Pädagogik – Didaktik – Politik – Erich Schmidt Verlag – 2017
Die Kurzbeschreibung dieses Buches hat mich sofort angesprochen. Aber als ich dann das Kapitel „Zum Anredeverhalten in Gesellschaft und Grundschule“ las, wurde meine Begeisterung stark gebremst. Ich legte das Buch erst einmal zu Seite. Als ich es zum zweiten Mal in die Hand nahm, begann ich mit dem Kapitel „Rechtschreibung im Rahmen des Schriftspracherwerbs“, war fasziniert und las den Rest des Werks zügig.
Es geht sofort zur Sache. Zum Rechtschreiben nach Gehör werden die Vorteile und Nachteile klar aufgezeigt. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, wie problematisch dieser Ansatz ist und wie bei reformpädagogischen Konzepten überhaupt der Nachweis der Effektivität fehlt. So heißt es auf Seite 63, dass die Analysen Hatties ergeben haben, dass offener Unterricht ohne Wirkungen für erfolgreiches Lernen bleibt.
Spannend ist auch das Kapitel über die Schulschriften. Es wird deutlich – ich weiß das aus meiner Praxis auch – dass viele Schüler ihr Handwerkszeug, nämlich die Schrift, nicht beherrschen. Das behindere die Lernmöglichkeiten ganz generell. Der Übergang von der durch die Anlauttabelle zwangsweise zu praktizierenden Druckschrift zu einer Schreibschrift, die leichter und flüssiger von der Hand gehen soll, funktioniert nicht, weil zu wenig geübt wird. Viele Schüler sehen auch gar nicht ein, warum sie eine zweite Schrift erlernen sollen. „Jedes Kind soll selbstbestimmt seinen eigenen Weg zur individuellen Handschrift finden.“ Der Autor sagt dazu, dass es nicht Aufgabe der Schule sein kann, sich unreflektiert dem Zeitgeist zunehmender Individualisierung, Vermeidung von Anstrengung und rascher Bedürfnisbefriedigung anzuschließen. Bravo, sage ich da. Mit Blick auf China, wo die wirklich schwierigen chinesischen Schriftzeichen nicht abgeschafft wurden, kommentiert der Autor, dass die hierzulande intensiv diskutierten Vorschläge, das Schreibenlernen noch weiter zu vereinfachen, einem seltsam vorkommen müssen.
Sehr gut gefallen hat mir auch die Dokumentation zur Veränderung von Schülertexten ab Seite 142.
Die Ausführungen zu Schulkulturen im Zusammenhang mit verschiedenen Punkten, insbesondere dem Anredeverhalten, sind insgesamt wirklich spannend zu lesen. Beispielsweise stellt der Autor fest, dass in Grundschulen, an denen Schüler ihre Lehrer siezen, stärker auf Rechtschreibung geachtet werde als dort, wo die „Du-Anrede“ vorherrscht.
Ich habe mich aber gewundert, wie bei den vielen klaren Erkenntnissen zur Reichen-Methode und auch zum offenen Unterricht sich doch auf politischer Ebene gar nichts tut. Aufgefallen ist mir im Buch, dass Bayern im Vergleich oft ganz gut dasteht. Ich sehe das auch so. Aber auch in Bayern wird nach der Anlauttabelle gelernt, und die Diktate wurden vor einiger Zeit abgeschafft, wohl kaum, weil die Schüler so gut geschrieben haben.
Günther Thomé - ABC und andere Irrtümer über Orthographie, Rechtschreiben, LRS/Legasthenie ♥
Schon die 5. Auflage! Ich liebe dieses Buch, weil es die wichtigen Probleme auf den Punkt bringt! Es ist verständlich und vergnüglich geschrieben und garantiert Aha-Erlebnisse!
Ein ungewöhnliches Fachbuch: Voll von klugen Gedanken und Zitaten, interessanten Aspekten, nützlichen Informationen und, vor allem: nie langweilig. Neun Themen, die als Irrtümer überschrieben sind, werden beginnend mit einem Dialog zwischen den Herren „Bisher Dachtemann“ und „Dagegen Weißmann“ in ansprechender Weise behandelt. Es sind Themen, denen ich in meiner praktischen Arbeit als Lese- und Rechtschreibtrainer auch schon begegnet bin. Zum Beispiel: „Rechtschreiben lernt man durch das Lesen“. Mit diesem Irrtum startet das Buch. Die Argumente und Beispiele, die dazu aufgeführt werden, machen sofort klar, dass das nicht stimmt. So soll man z.B. einzelne Fragen zum Ziffernblatt seiner Armbanduhr beantworten, auf die man ja täglich mehrmals schaut. Man erkennt mit jedem Blick auf die Uhr die Zeit, aber man achtet nicht auf die Details des Ziffernblattes. Anderes Thema: Dass die Schüler früher besser rechtschreiben konnten als heute, das ist, wie der Autor schreibt, leider kein Irrtum. Dieses Kapitel sollten Bildungspolitiker und deren Financiers lesen und beachten. Noch während meiner Berufstätigkeit in einem großen Unternehmen fiel mir auf, dass die jungen Leute, es handelte sich ausschließlich um Akademiker, für meine Ansprüche große Probleme mit der Grammatik und der Rechtschreibung hatten. Heute weiß ich, und die Analyse des Autors bestätigt das, dass das systembedingt ist und nicht auf der Schlampigkeit der jungen Leute beruht, wie ich zunächst dachte. Auch der Irrtum „Die Unterrichtsmaterialien sind geprüft und korrekt“ ist sehr lehrreich. Ich zitiere: „Alles, was wir zuerst und oft hören, sitzt ziemlich fest. Manchmal ist das gut. Manchmal ist das schlecht, z.B. bei den Buchstabennamen: A, E, I, O, U!“ Wie wahr, denke ich da mit Bezug auf mein Rechtschreibtraining. Die Kinder können lange und kurze Vokale nicht unterscheiden. Ich muss ihnen das mühsam beibringen. Oder, Irrtum Nummer 7: „Je früher, desto besser“. Aber das ist doch kein Irrtum denke ich spontan. Aber Herr Weißmann sagt: „Zu früh und zu viel ist – außer beim Frühling – absolut verkehrt.“ Und schon fallen mir die Schüler ein, die zu früh zum schnellen Lesen verführt werden und sich dadurch eine falsche Lesestrategie aneignen, die ihnen später große Probleme bereitet. Das waren jetzt nur einige wenige Anmerkungen zu einem Feuerwerk klarer Analysen und überzeugender Argumente. Ein Lesevergnügen!
Thomé, Günther - DEUTSCHE ORTHOGRAPHIE ♥
Thomé, Günther – DEUTSCHE ORTHOGRAPHIE
Günther Thomé – DEUTSCHE ORTHOGRAPHIE – HISTORISCH, SYSTEMATISCH, DIDAKTISCH – 2018 isb-Fachverlag, Oldenburg – ISBN 978-3-94212224-5
Wer schon einmal ein Buch von Prof. Thomé gelesen hat, wird auch dieses gerne lesen. Für alle aber gibt es einen guten Überblick über das Thema. Mit einer Träne im Auge werden Therapeuten im Kapitel zur Historie lesen, dass ein gewisser Raumer im Jahre 1855 empfohlen hat, das „v“ in der f-Lautung durch „f“ zu ersetzen. „Wenn er sich nur durchgesetzt hätte“, geht es einem da durch den Kopf. So bleibt Lehrern und Therapeuten die schöne Aufgabe, sinnlose Schreibungen nach dem historischen Prinzip den Kindern zu vermitteln. Dieser weise Mensch hat übrigens damals auch gefordert, nach Kurzvokalen kein „ß“ mehr zu schreiben, sondern „ss“.
Grapheme und Phoneme werden anschaulich beschrieben. Interessant sind auch die Ergebnisse der 100.000er-Auszählung. Viel diskutierte Phänomene erscheinen hier plötzlich nicht mehr so schrecklich, wenn man sieht, dass der Laut /αι/ zu 99,53 Prozent mit ei (drei), zu 0,3 Prozent mit eih (weihen) und zu 0,17 Prozent mit ai (Mai) verschriftet wird. Auch die Einteilung in Basisgrapheme und Orthographeme lernt man verstehen. Man erhält im dritten Kapitel einen guten Überblick über die Konzepte des Rechtschreibunterrichts. Ich denke mir dabei, dass die Methode, mit der ich in den Fünfzigerjahren gelehrt wurde, gar nicht so schlecht gewesen sein kann. Wir wurden nicht damit traktiert, Laute in Grapheme umzusetzen. Wir haben einfach zwei Jahre lang vorgegebene Texte geschrieben, und nur Wörter, die wir gelernt hatten. Dabei ist wahrscheinlich die im Buch erwähnte innere Regelbildung erfolgt, die ich bei allen meinen Schülern schmerzlich vermisse.
Ganz wichtig sind die Anmerkungen zu den Silben. Die Duden-Silben gehen auf die Schriftsetzer zurück, die 1903 den sogenannten Buchruckerduden geschaffen haben. Professor Thomé meint dazu auf Seite 75: „Die Worttrennung am Zeilenende, wie sie für den Schriftsatz im Buchdruck Anfang des 20. Jhs. im sog. „Biuchdruckerduden“ (Duden 1903) festgeschrieben wurde, läuft dem orthographischen System zuwider. Diese Silbentrennung sollte im Schriftsprachunterricht der srsten Schuljahre keinen Platz haben. Schließlich bilden wir in der Grundschule keine Schriftsetzer aus.“
Neu für mich war, dass es neben einem kurzen und einem langen e auch noch das sogenannte Schwa (schwaches e) gibt. Im Schulbetrieb kommt das kaum vor, weswegen es etliche Kinder gibt, die sich basierend auf der Anlauttabelle, heute auch Schreibtabelle genannt, eine falsche Betonung aneignen, denn in der Anlauttabelle gibt es dieses Schwa nicht. Ich nenne es übrigens auch abfallendes e. Typische Beispiele: Hase und Hammer.
Wer sich einen Überblick über das Thema deutsche Orthographie verschaffen möchte, ist mit diesem Buch sehr gut bedient.
Thomé/Thome - Ratgeber Rechtschreibprobleme ♥
Thomé/Thomé – Ratgeber Rechtschreibprobleme
Dorothea Thomé & Günther Thomé – Ratgeber Rechtschreibprobleme LRS/Legasthenie – Erfahrungsberichte Perspektiven Auswege – isb Institut für sprachliche Bildung Oldenburg – 2021, 2., verbesserte Auflage – ISBN 978-3-94212201-6
Ich war schon von der ersten Auflage begeistert.
Das Buch ist gut gegliedert und verständlich geschrieben. Es enthält bewegende Geschichten betroffener Kinder und Eltern mit vielen Beispielen und erklärende Hintergrundinformationen sowie nützliche Tipps, was man bei Rechtschreibschwierigkeiten tun kann.
Eine der Kernbotschaften: „Entscheidend ist, dass an den konkreten Problemen des Kindes sinnvoll gearbeitet wird.“
Zur Frage, ob die Rechtschreibung früher besser war, stellen die Autoren fest: „Wenn man etwa dreißig Jahre alte Maßstäbe an die heutigen Rechtschreibleistungen anlegen würde, könnte man gut die Hälfte unserer Schüler als rechtschreibschwach bezeichnen!“
In die Berichte von Eltern und Kindern kann man sich gut hineinvertiefen. So einiges davon habe ich auch erlebt. Und oft wird deutlich, dass viel Zeit verschwendet wird, weil nach Schema vorgegangen wird. Aus den Erfahrungen anderer kann man hier viel lernen.
Sehr gelungen sind auch die Textbeispiele, bei denen der Schülertext orthographisch richtig und danach mit den Originalfehlern dargestellt wird. Man erlebt dadurch, wie durch schwache Rechtschreibung der gute Inhalt leicht untergeht.
Das Kapitel „Rat und Tat“ macht ungefähr die Hälfte des Buches aus. Da steht einiges, was die Verantwortlichen in den Kultusministerien lesen sollten, was aber auch für Eltern und Trainer wichtig ist. Zum Beispiel wird mit der Forderung, schneller zu werden, vieles falsch gemacht. Herrlich passt dazu ein Satz von Johann Amos Comenius (1592-1670): „Der Vogel wirft seine Eier nicht etwa ins Feuer, damit die Jungen schneller ausschlüpfen, sondern brütet sie ganz langsam mit der natürlichen Wärme aus.“ Klar, was das bezogen auf das Lernen bedeutet.
Auch das Lernmaterial, sprich die Schulbücher, tragen manchmal zu falschem Lernen bei. Die Beispiele kann ich noch ergänzen, mit einem Lehrbuch, das ich gerade in einer Schule gesehen habe, in dem Nomen dadurch geübt werden, dass man in einem langen Text vor jedem Nomen den Artikel kennzeichnen soll, der tatsächlich auch vor jedem Nomen steht. Es gibt in diesem Text keine gleichlautenden Pronomen oder Artikel ohne ein Nomen danach. Kein Wunder, wenn, was ich oft erlebe, die Schüler dann „die Schöne blume“ schreiben. Nomen erkennt man im richtigen Leben nämlich nicht daran, dass immer ein Artikel davorsteht.
In dieses Kapitel gehört auch das Basiskonzept, das die Autoren entwickelt haben und das davon ausgeht, zuerst die häufigeren Schreibungen zu lernen, bevor es an die Ausnahmeschreibungen geht. Ja, so müsste es sein! Das ist wieder so eine Stelle im Buch, die man auch in den Kultusministerien zur Kenntnis nehmen sollte. Ich fürchte allerdings, dass man dieses Prinzip dort kennt, es aber dem Grundsatz, dass sich die Kreativität der Kinder so früh wie möglich entfalten soll, untergeordnet wird. Deswegen sollen die Kinder frei schreiben, obwohl sie weder die Handschrift noch die Rechtschreibung beherrschen. Damit wird jedes noch so schöne Basiskonzept über den Haufen geworfen.
Sehr treffend fand ich auch die Schilderung der fehlgeleiteten Versuche, das Dehnungs-h (oder die manchmal auch als Trennungs-h bezeichnete Variante) hörbar zu machen. Alle geschilderten Probleme in diesem Kapitel kenne ich aus meiner Praxis. Eltern dürfte beim Lesen dieses Kapitels so einiges klar werden.
Das kurze Kapitel über Vornamen muss ich mit einem eigenen Beispiel ergänzen. Der ungewöhnliche Mädchenname, den ich hier nicht wiedergebe, war so konstruiert: KVK-KV. Ich habe den Vokal in der ersten Silbe kurz gesprochen. Das Mädchen sagte aber, der Vokal in der ersten Silbe wäre lang, so sprechen den Namen auch die Eltern aus. Und tatsächlich, das Mädchen liest in gleich gebauten Wörtern den eigentlich kurzen Vokal lang. Daran habe ich jetzt zu arbeiten.
Es folgen im Buch dann praktische Hinweise, die gut umgesetzt werden können.
Zum Schluss wünschen sich die Autoren kleinere Klassen, bessere Betreuungsangebote für Kinder, und sie beantworten die Frage, wer das bezahlen soll, verblüffend mit dem Hinweis, dass mit dem Geld, das für die Folgekosten von Arbeitslosigkeit, Analphabetismus usw. ausgegeben werden muss, eine Luxusausbildung für alle finanziert und dabei noch gesamtgesellschaftlich gespart werden könnte. In der Sprache meines früheren Lebens als Manager hieße das, brutal formuliert: In die Produktqualität muss investiert werden, nicht in die Reklamationsabteilung!
Das Buch gibt es inzwischen in einer Neuauflage.
Rechtschreibung - Thomé-Thomé - Professionelles Wissen über Rechtschreibung
Rechtschreibung – Thomé/Thomé – Professionelles Wissen über Rechtschreibung
Günther Thomé – Dorothea Thomé – PROFESSIONELLES WISSEN über RECHTSCHREIBUNG für Schule und Förderung – Orthographeme – 2022n- isb Fachverlag – isbn 978-3-94212234-4
Dieser Titel ist gerade im isb Fachverlag erschienen. Die beiden Autoren beschäftigen sich darin mit den Orthographemen, also den Schreibungen, die neben der Lautung auch noch andere Hinweise transportieren, zum Beispiel eine historische Schreibung. Das Thema wird – wie von den Autoren gewohnt – systematisch angegangen. Zu allen Rechtschreibthemen gibt es – Rechtschreibtrainer werden das gut nutzen können – Wörterlisten, bei denen die Rechtschreibbesonderheit auch optisch hervorgehoben ist. Zudem sind die Wortstämme grau hinterlegt. Zum Üben mit den Kindern gibt es Vorschläge und Hilfsmittel.
Türcke, Christoph - Hyperaktiv! - Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur

Türcke, Christoph – HYPERAKTIV! – Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur
Christoph Türcke, Verlag C.H. Beck
„ADHS ist nicht einfach eine Krankheit in gesunder Umgebung. Umgekehrt: Nur wo schon eine Aufmerksamkeitsdefizitkultur besteht, gibt es ADHS.“
Dieser Satz, der vom Autor nicht nur so einfach in den Raum gestellt wird, sondern ausführlich begründet wird, macht ein Problem unserer Gesellschaft deutlich. Mich hat das Buch fasziniert. Es beschreibt nicht nur, wie und warum es zu diesem Phänomen gekommen ist. Es werden auch Lösungsansätze aufgezeigt.
Für alle, die sich mit dem Erlernen des Lesens und Schreibens beschäftigen, gibt es in diesem Zusammenhang sehr Nachdenkenswertes zu lesen. Unter anderem weist der Autor darauf hin, dass früher unter „weit stabileren Wiederholungsstrukturen“ gelernt wurde. Da fällt mir meine Urgroßmutter ein, die, wenn ich von der Schule kam, mich die Hausaufgaben immer zweimal machen ließ. Sie hat mir damit sehr geholfen, auch wenn mir das damals nicht klar war. Der Autor prangert auch an, dass es heute immer mehr in die Richtung geht, dass jedes Kind so schreiben kann, wie es will. Da wird die „Freiheit“ der Kinder in gewisser Weise zu einer Desorientierung. Es wird kein Wert mehr auf Üben und Wiederholungen gelegt. Das Ergebnis erlebe ich im Alltag. Es ist oft ein Geschmiere, das man nur schwer als richtige Schrift erkennen kann. Auf Wiederholung und Ausdauer wird offenbar offiziell nicht mehr viel Wert gelegt. Der Autor spricht dann auch von einer „konzentrierten Zerstreuung“. Deregulierung ist in unserem Bildungssystem modern. Es gelte aber, wieder zu Ritualen zu kommen. Hier wird dann auch für mich der Sinn der Ausführungen über Opferrituale unserer Vorfahren am Anfang des Buches verständlich.
Das Buch ist sehr empfehlenswert. Es macht nachdenklich. Um auf das Zitat ganz oben zurückzukommen: Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom könnte doch auch bedeuten, dass „wir“ unseren Kindern zu wenig Aufmerksamkeit widmen und ihnen zu wenig an Stetigkeit vermitteln.
Christoph Türcke ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Türcke, Christoph - Lehrerdämmerung - Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet

Christoph Türcke – LEHRERDÄMMERUNG – Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet – C.H. Beck, 2016
Die Auswirkungen der neuen Lernkultur sind für mich als ehrenamtlichen Lesetrainer und sicher für viele Kollegen und Hausaufgabenbetreuer täglich zu spüren. Deswegen habe ich dieses Buch gekauft und in einem Satz verschlungen.
Der Autor beschreibt, wohin es führen wird, wenn die Elementartechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen nicht mehr beherrscht werden, weil die Beschäftigung damit der modernen Auffassung vom Lernen nicht standhält. Am Beispiel der Handschrift erläutert der Autor das so: „Warum sollte man es denn ihnen [den Kindern] unnötig schwer machen mit all den geschwungenen Linien, die die lateinische Schreibschrift verlangt? So erfand man eine ´vereinfachte Ausgangsschrift´ mit weniger Schwüngen und Kringeln. Wurde die Handschrift seither besser und geläufiger? Im Gegenteil. Nun, warum dann überhaupt noch auf einer Schreibschrift bestehen? Druckbuchstaben tun es doch auch.“ Das ist leider Realität. Wie so oft heutzutage: Plagen ist out. Lieber reduziert man die Anforderungen. An anderer Stelle im Buch schreibt der Autor zu dieser Entwicklung: „In allen Bildungsstandards drängen die soft skills nach vorn. Hard skills wie Kopfrechnen, Rechtschreibung, Memorieren werden widerwillig mitgeschleppt und erodieren. Sie gelten nicht mehr als mentale Elementartechniken, nicht mehr als Unterbau höherer Leistungen, sondern unter der Würde von Kindern, die durch kreatives Entdecken statt durch Pauken vorankommen sollen.“ Und dann folgt das wunderbare Beispiel vom Fußballtrainer, der Kraft- und Konditionstraining auf eine Aufwärmphase reduziert, um mehr Zeit fürs Eigentliche (für das Fußballspielen) zu gewinnen. Damit sägt man an dem Ast, auf dem das Eigentliche sitzt.
Nachdem sich der Autor ausführlich und mit anschaulichen Beispielen mit dem Kompetenzwahn in der Schulpolitik und mit dem Inklusionswahn auseinandergesetzt hat, beschreibt er die Rolle des Lehrers, wohin sie sich entwickelt und worin sie eigentlich besteht. Lehrer dürfen sich nicht zu Kompetenzbeschaffungsgehilfen degradieren lassen. Frontalunterricht, richtig gestaltet, ist gemeinsame „Jetztzeit“ und Grundlage für Wiederholung, Vertiefung usw. Die Lehrer „zeigen“ den Schülern etwas und entfachen Interesse, das dann wiederholt, variiert und vertieft wird, und zwar in der Klasse, in Kleingruppen, bei Hausaufgaben usw.
Als ehrenamtlicher Lesetrainer dachte ich beim Lesen oft: Aus der Praxis, für die Praxis! Siehe dazu auch meine Blogbeiträge „Auf Sand gebaut – schwer zu entziffern“ und „Warum gibt es beim Diktat nicht lauter Einser?“ Weil es letztlich auf die Lehrer und nicht auf die Schulbürokratie ankommt, besteht noch Hoffnung!
Siegbert Rudolph, 26. März 2016
Winterhoff, Michael - Deutschland verdummt
Winterhoff, Michael – Deutschland verdummt
Michael Winterhoff – Deutschland verdummt – Wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut – Gütersloher Verlagshaus – ISBN 978-3-579-01468-5
Der Autor macht darauf aufmerksam, dass sich die Psyche vieler Kinder aufgrund des Umgangs im Elternhaus und der Methoden in Kindergärten und Schulen nicht richtig entwickeln kann, warnt vor den Konsequenzen und zeigt notwendige Maßnahmen auf. Die Beispiele, die er bringt, und die Symptome, die er aufzeigt, erinnern mich an so manche Schüler, die ich im Laufe der letzten zehn Jahre gefördert habe.
Dass man Kindern nur freie Bahn lassen muss, damit sie sich ganz von allein – also autonom – zu verantwortungsbewussten und sozial kompetenten Erwachsenen entwickeln – das ist das Zentrum der Verirrungen in der Bildungspolitik. Immer wieder prangert der Autor an, dass man heute meint, mit Kindern auf Augenhöhe verhandeln oder sie als kleine Erwachsene behandeln zu müssen. Die Psyche des Kindes, die die Orientierung am Erwachsenen, an Bezugspersonen, für ihre Entwicklung braucht, wird nicht gestärkt. Offener Unterricht ist da genau die falsche Methode. Sehr schön finde ich dazu dieses Zitat: „Die Entscheidung, die wir Erwachsenen dringend für unsere Kinder treffen müssen, ist nicht die zwischen ´offenem Unterricht´ und ´Frontalunterricht´. Sondern die zwischen ´Unterricht, in dem die Kinder alleine gelassen werden´, und ´Unterricht, in dem die Kinder von Lehrern angeleitet und begleitet werden.´“
Etliche Kapitel erhalten erläuternde, praxisbezogene Interviews mit Personen aus dem Schulbetrieb. Beispiel, Lehrerin an einer 5. Klasse in einem Gymnasium: „Die Fähigkeiten, über die Zehnjährige nach vier Jahren kompetenzorientierter Grundschule verfügen, sind leider sehr überschaubar. Den meisten Kindern fehlt es an den kulturellen Grundlagen Rechnen, Schreiben und Lesen.“ Ich höre so etwas auch von Lehrern an Mittelschulen.
Im Kapitel „Die Lehrer – Kinder wieder anleiten, statt ihr Lernbegleiter zu sein“ gibt der Autor Hinweise, was Lehrer tun können. Zum Beispiel in ihrer psychischen Entwicklung zurückgebliebene Kinder identifizieren, um ihnen so begegnen zu können, wie es bezogen auf ihren Entwicklungsstand angemessen ist. Auch: „Klare Anweisungen geben, mit den Kindern in Kontakt sein und aus dem Einzelkämpfer-Status herausfinden, also in Teams mit verschiedenen Mitgliedern der heilpädagogischen Berufe zusammenarbeiten.“
„Am Anfang der Probleme, die wir aufgrund der vielen nicht entwickelten Kinder und Jugendlichen haben, stehen ihre Eltern.“ Und hier beschreibt der Autor seine Theorie der in der Symbiose gefangenen Eltern, die das Kind als einen Teil von sich betrachten. Auch das konnte ich in meiner bescheidenen Praxis schon beobachten. Solche Kinder steuern ihre Eltern. Und diese sind oft im „Katastrophenmodus“ gefangen. Die Kinder können sich psychisch nicht entwickeln. Sie müssten in Kindergarten und Schule nachreifen. Das Tragische dabei ist, „´autonomes Lernen´ und Entwicklung der Psyche sind diametral entgegengesetzt“. Gut gefallen hat mir, dass der Autor den Wert von Hausaufgaben betont und den richtigen Umgang damit erläutert.
Ein Kapitel ist der zunehmenden Pathologisierung der Kinder gewidmet. Der Autor spricht von einer „grassierenden Diagnoseritis“. Im Zusammenhang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten kann ich das aus meiner Praxis nur bestätigen.
Sehr gut gefallen hat mir folgende Erläuterung: „Seine (Junge aus der Praxis des Autors) Untersuchung zeigte unter anderem, dass er einen IQ von 140 hat; … Doch diese Grundintelligenz trägt nur einen gewissen Teil dazu bei, ob ein Leben gelingt. Sie ist wie die Festplatte eines Computers. Ganz gleich, wie groß sie ist – es kommt auf das Betriebssystem an, also auf die emotionale und soziale Intelligenz. Die Grundintelligenz ist angeboren, doch emotionale und soziale Intelligenz müssen erworben werden.“
Im letzten Kapitel „Bildungsoffensive“ sagt der Autor, was nötig ist. Unter anderem die Dinge beim Namen nennen, also nicht mehr schönreden. Ich habe das schon oft erlebt: In der Schule klagen Lehrer über Unterrichtsausfall. Kurz darauf höre ich im Radio den zuständigen Minister, der stolz erklärt, dass kein Unterricht ausgefallen ist. Nach seiner Definition ist Unterrichtsausfall nur dann, wenn die Kinder heimgeschickt werden. Das werden sie aber nicht, auch wenn viele Lehrer krank sind, sie kommen mit anderen Klassen zusammen, gucken einen Film oder werden sonst wie beschäftigt.
Außerdem müsse die Sparpolitik im Bildungswesen gestoppt werden. Von der Digitalisierung der Kindergärten und Grundschulen hält der Autor – genau wie ich auch – nichts.
Winterhoff, Michael – Tyrannen müssen nicht sein
Winterhoff, Michael – Tyrannen müssen nicht sein – 1. Auflage – Goldmann – 2011
Praktisch ist das Buch ein Nachwort zum vorhergehenden Titel „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“. Der Autor setzt sich mit den Reaktionen auf sein erstes Werk auseinander. Die verschiedenen Stufen der Beziehungsstörung werden noch einmal verständlich und trotz Wiederholung sehr interessant beschrieben. Die Ursache der Probleme wird immer deutlicher. Zitat Seite Seite 29: „Akzeptanz des Kindes, Eingehen auf seine Wünsche und Bedürfnisse haben sich gegenüber ausschließlich autoritär ausgerichteten Erziehungsstilen stark verbessert. In dieser Hinsicht wird heute modern gedacht. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer.“ Man sieht heute das Kind nicht als Kind, sondern als Partner auf Augenhöhe. Aber ein Kind kann diese Rolle nicht leisten, es ist überfordert. Dazu werden die Entwicklungsstufen, die das Kind durchläuft, ausführlich beschrieben. Zum Beispiel dass das Kind erst mit drei Jahren zwischen sich und seinen Gegenübern unterscheiden lernt. Erst ab dem 15. Lebensjahr kann ein Mensch voll für sein Handeln haftbar gemacht werden.
Sehr instruktiv sind die Beispiele aus der Praxis des Autors. Man erkennt sehr gut, dass viele Kinder tatsächlich auf einer frühen Stufe der psychischen Entwicklung stehen geblieben sind und in einer frühkindlichen Welt leben, in der es nur ein Sofort und kein Später gibt. Ein unerzogenes Kind ist in Wirklichkeit ein nicht entwickeltes Kind.
Sehr gut haben mir die Ausführungen zu den Konzepten gefallen, nach denen die Kinder betrachtet werden. Das Konzept „Kind als Kind“ wird leider häufig durch andere Konzepte ersetzt, beginnend mit dem Konzept „Kind als Partner“. Und immer gibt es im Buch nicht nur Theorie, sondern einen überzeugenden Bezug zur Praxis. Die verschiedenen Konzepte führen zu zahlreichen Kommunikationsstörungen, z.B. auch zwischen Lehrern, die dem Konzept „Kind als Kind“ verpflichtet sind und ihre Kinder als Schützlinge sehen, und solchen, die die Kinder als Partner sehen. Aber Kinder sind noch nicht voll entwickelt und können schon deshalb keine Partner sein, die ihre Entscheidungen alle selbst treffen können. Trotzdem werden Lehrer, die ihre Schüler als Kinder sehen, oft als reaktionär angesehen und kritisch beäugt.
Der Autor beleuchtet auch die Entwicklungsperspektiven unserer Gesellschaft unter dem Vorzeichen fehlender Psycheentwicklung ebenso wie die private Sphäre. Was das alles für Kindergarten und Schule bedeutet? Die Defizite werden aufgedeckt, und da muss ich oft an meine Erfahrungen denken. Zitat Seite 203: „Die Konzepte, die seit Jahren Eingang in die Arbeitsprozesse an Schulen und Kindergärten gefunden haben, sind im Wesentlichen partnerschaftlicher Natur. Hier sind über viele Jahre hinweg Sünden begangen worden, deren Auswirkungen heute Schüler und Lehrer zu spüren bekommen. Anders gesagt: Das Konzept „Kind als Partner“ ist in dieser Zeit in markige pädagogische Leitsätze gegossen worden. Es wird als modernes Menschenbild und Fortschritt beim Umgang mit Kindern verkauft und nicht als Ursache für Probleme gesehen.“ Seite 206: „Es gilt als modern, den Alltag an der Schule möglichst offen und eher unverbindlich zu halten. Man überträgt hier hart erstrittene Erwachsenenrechte eins zu eins auf Kinder und lässt sie dann damit allein. Das ist fatal.“ Reformen und neue Methoden haben nach kritischer Überprüfung nichts gebracht. Die Schüler sind weder disziplinierter noch leistungsstärker geworden. Seite 217: „Wir haben heute immer mehr Kinder als früher, die den Entwicklungsstand nicht haben, um das leisten zu können, was die Reformansätze ihnen abverlangen. Und wir haben immer weniger Elternhäuser, die solche Fehlentwicklungen in der Schule auffangen können. Es wurde mittlerweile an so vielen Stellschrauben gedreht, dass keiner mehr weiß, was welche Auswirkungen hat.“
Mit dem Kapitel „Was ist zu tun?“ schließt das Buch. Ob die überzeugend beschriebenen Maßnahmen ergriffen werden? Spätestens beim Unterkapitel „Wachrütteln der politischen Instanzen“ muss man leider zweifeln. Mir hat das Buch wertvolle Hinweise für meine Arbeit gegeben.
Wolf, Maryanne - Das lesende Gehirn ♥
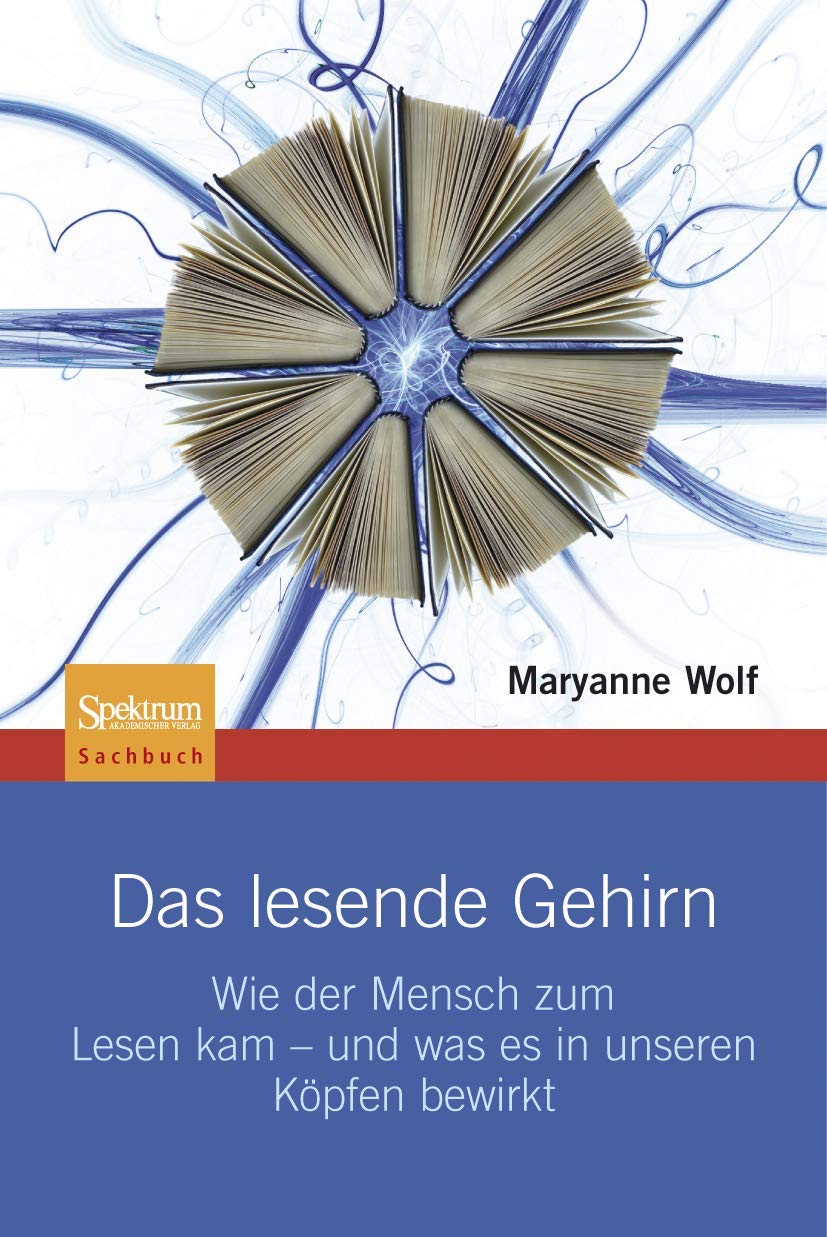
Wolf, Maryanne – Das lesende Gehirn
Das war das erste Fachbuch, das ich zum Thema Lesen, Legasthenie und LRS gelesen, ja verschlungen habe. Ein tolles Buch für alle, die sich in verständlicher Sprache und mit anschaulichen Beispielen über dieses spannende Thema informieren wollen:
Maryanne Wolf, Das lesende Gehirn – Wie der Mensch zum Lesen kam – und was es in unseren Köpfen bewirkt, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2009
Einige Zitate daraus:
Seite 5: Das Gehirn kann lesen lernen, weil es in der Lage ist, neue Verbindungen zwischen Strukturen und Schaltkreisen herzustellen, die ursprünglich für fundamentalere und evolutionär ältere Hirnprozesse, wie Sehen oder Sprechen, zuständig waren.
Seite 98: Die letzten Jahrzehnte der Forschung haben gezeigt, dass das spätere Lesevermögen eines Kindes stark davon beeinflusst wird, wie oft und wie lange die Eltern und andere Bezugspersonen ihm vorlesen.
Am schönsten ist die Geschichte eines kleinen sympathischen Jungen, der Schwierigkeiten beim Lesenlernen hatte. Der wurde immer kleinlauter. Bis die Lehrerin nach Schulschluss sich mit ihm zusammensetzte und übte. Und irgendwann konnte er es. Diese Mühe lohnt immer.
Seite 142: Andrew Biemiller hat typische Fehler von Kindern in Timmys Alter untersucht und herausgefunden, dass junge Leseanfänger häufig drei kurze, gut vorhersagbare Phasen durchlaufen. Zuerst produzieren sie falsche Wörter, die semantisch und syntaktisch passen, aber keine phonologische oder orthographische Ähnlichkeit mit dem richtigen Wort aufweisen (Papa für Vater). Wenn sie erst einmal einige Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln erlernt haben, weisen ihre falschen Wörter eine orthographische Ähnlichkeit mit dem richtigen Wort auf, passen aber semantisch nicht gut (Timmys horse statt house). Am Ende ihrer Zeit als Leseanfänger produzieren Kinder falsche Wörter, die sowohl orthographisch ähnlich sind als auch semantisch passen (Leine für Linie).
Seite 146: Versuchen Sie einmal, diese Begriffe laut zu lesen: Periventrikuläre moduläre Heterotopie, Psychiatrie, fiduziarisch, Mikrospektroskopie. Wie schnell Sie die einzelnen Wörter lesen, hängt nicht nur von ihrem „Decodiervermögen“ ab, sondern auch von Ihrem Hintergrundwissen.
Seite 155: Flüssiges Lesen ist keine Frage der Geschwindigkeit. Es geht vielmehr um die Fähigkeit des Kindes, sein gesamtes spezielles Wissen über ein Wort – seine Buchstaben, Buchstabenmuster, grammatischen Funktionen, Wurzeln und Endungen – so schnell zu nutzen, dass ihm noch Zeit zum Denken und Verstehen bleibt. Alle Kenntnisse über ein Wort tragen zu der Geschwindigkeit bei, mit der es gelesen werden kann.
Seite 160: Neuere Berichte des National Reading Panel und andere staatliche Statistiken weisen darauf hin, dass 30 bis 40 Prozent der Viertklässler in den USA nicht lernen, wirklich flüssig zu lesen und dabei den Text ausreichend zu verstehen. Das ist eine niederschmetternde Zahl. Noch schlimmer wird die Sache dadurch, dass Lehrer, Lehrbuchautoren, ja das gesamte Schulsystem von Schülern ab der vierten Klasse ganz andere Dinge erwarten. Diese Erwartung drückt sich in dem Mantra aus, dass ein Kind in den ersten Schuljahren „lesen lernt“, und in den darauffolgenden Schuljahren „liest, um zu lernen“. Nach der Versetzung in die vierte Klasse erwarten die Lehrer von den Kindern ausreichend automatisierte Lesefertigkeiten, um, auf der Basis zunehmend schwierigerer Texte, immer mehr selbstständig lernen zu können.
Seite 193: Ich würde lieber den Dreck um die Badewanne wegwischen als lesen. Kind mit Legasthenie
Seite 195: Was mich und meine Kollegen in der Legasthenieforschung frustriert, ist, dass dieser Kreislauf des Misserfolgs größtenteils vermeidbar wäre.
Wenn wir uns an die Erforschung der Legasthenie wagen, merken wir bald, dass auf diesem Feld ein großes Durcheinander herrscht.
Seite 196 (312): Was ironischerweise fehlt, ist eine spezifische, universell akzeptierte Definition von Legasthenie.
British Psychological Society: „Legasthenie liegt vor, wenn sich das genaue und flüssige Lesen und/oder Buchstabieren von Wörtern sehr lückenhaft oder unter großen Schwierigkeiten entwickelt.“
International Dyslexia Association: „Legasthenie ist eine spezifische Lernschwäche neurologischen Ursprungs. Sie ist gekennzeichnet durch Probleme bei der genauen und/oder flüssigen Worterkennung sowie durch fehlerhaftes Buchstabieren und Entziffern. Diese Probleme beruhen typischerweise auf einem Defizit in der phonologischen Sprachkomponente, das häufig mit anderen kognitiven Fähigkeiten kontrastiert und trotz einer effektiven Unterweisung im Unterricht auftritt. Sekundäre Folgen sind möglicherweise Schwierigkeiten beim Verstehen von Texten und eine geringere Leseerfahrung, was die Erweiterung von Wortschatz und Hintergrundwissen behindern kann.“
Seite 196: … dass das Gehirn aus der Perspektive der menschlichen Evolution nie darauf ausgelegt war zu lesen. Wie wir gesehen haben, gibt es weder Gene noch biologische Strukturen, die speziell dem Lesen dienen. Um lesen zu können, muss vielmehr jedes Gehirn lernen, neue Schaltkreise durch die Verknüpfung älterer Regionen zu bilden, die ursprünglich für andere Dinge, wie das Erkennen von Objekten und das Abrufen ihrer Bezeichnungen, angelegt und genetisch programmiert worden waren. Legasthenie kann nichts so Simples sein wie ein Fehler im „Lesezentrum“ des Gehirns, weil so etwas gar nicht existiert.
Seite 253 – Mein Lieblingszitat zum Schluss: Der Aufbau des Gehirns machte Lesen möglich, und Lesen wiederum verändert das Gehirn nach wie vor auf vielfältige, entscheidende Weise.
Zierer, Klaus - Hattie für gestresste Lehrer
Zierer, Klaus – Hattie für gestresste Lehrer
Klaus Zierer – Hattie für gestresste Lehrer – Schneider Verlag Hohengehren – 2016
Über die Hattie-Studie hatte ich bisher nur einen Artikel gelesen, und mich – wie schon öfters – gewundert, mit wie viel wissenschaftlichem Aufwand Banalitäten als Erkenntnis verkündet werden. Das ist auch dem Autor bewusst. Dass es auf die Lehrerarbeit, also auf die Lehrpersonen ankommt, das ist der entscheidende Punkt der Hattie-Studie, und der zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Buch. Es ist aber auch wirklich wichtig, dass dieser Punkt bewusst gemacht wird, weil er bei vielen Diskussionen kaum eine Rolle spielt. Zum Beispiel ist der Faktor „Klassenstärke“ für den Bildungserfolg im Vergleich zum Faktor „Lehrperson“ verschwindend gering. Oder: Neue Lehrkonzepte stehen und fallen mit der Kompetenz der Lehrperson. Wie die Lehrkraft die neuen Konzepte in der Praxis umsetzt, das entscheidet über den Erfolg. Es wird aber auch deutlich, dass es Faktoren gibt, die die Lehrpersonen nicht beeinflussen können. Dazu gehören z.B. die Elternhäuser und die Anlagen der Schüler.
Immer wieder wird derzeit gefordert, dass der Lehrer in die Rolle eines Moderators schlüpfen soll. Hattie dagegen sieht den Lehrer als Regisseur, der sich für den Lernerfolg seiner Schüler verantwortlich fühlt. Beim Moderatorenkonzept, in dem der Lehrer viel weniger Einfluss ausübt, sieht er die Gefahr, dass es für die meisten Schüler höchst ineffizient ist.
Ich – als Berufsfremder – finde das Buch gut gegliedert und instruktiv. Man bekommt einen Einblick in die Methode und einen Überblick über die Relevanz dessen, was im Zusammenhang mit Bildungspolitik diskutiert wird. Ich habe mich schnell und leicht durch das Buch gelesen. Insoweit dürfte es auch für „gestresste Lehrer“ geeignet sein. Vielleicht ist der Hinweis auf den Lehrerstress aber auch so zu verstehen, dass die Hattie-Studie endlich die verdiente Anerkennung dieses Berufs bringt. Die haben viele Lehrer auch verdient. Das Personal in den Schulen zu fördern, das ist die wichtigste Aufgabe der Bildungspolitik. Alle, die in der Bildungspolitik etwas zu sagen haben, sollten die Hattie-Studie kennen.
Die für mich wichtigsten Botschaften sind:
• Der sozioökonomische Status der Eltern wirkt sich auf die schulischen Ergebnisse der Kinder aus. Das lässt sich nicht mit besonderen Schulformen korrigieren, nur die Lehrpersonen haben darauf einen positiven, aber auch begrenzten Einfluss.
• Die direkte Instruktion, also eine Form des Unterrichts, in der die Lehrperson klare Ziele verfolgt und die Schülerinnen und Schüler bewusst zur Zielerreichung hinführt, erreicht nach Hattie eine überdurchschnittliche Effektstärke. Diese Form des Unterrichts darf nicht mit „Frontalunterricht“ gleichgesetzt werden. Aber diese Unterrichtsform ist sowohl geschlossen als auch offen möglich. Auch hier kommt es darauf an, wie die Lehrperson den Unterricht gestaltet. Ich habe in meiner Schulzeit fast nur den lehrergeleiteten Unterricht erlebt (diese Bezeichnung gefällt mir besser als Frontalunterricht), und den habe ich im Zusammenhang mit ein paar Lehrern in sehr guter Erinnerung. Ich habe aber auch Lehrer gehabt, die diesen Beruf besser nicht ergriffen hätten.
• Bewusstes Üben ist wichtig. Das hat nichts mit einem Drill zu tun, aber es ist unstrittig, dass Wiederholungen mit Abwechslungen in den Aufgaben unerlässlich sind. Zeitlich versetztes Üben wird als effektiver als geballtes Üben angesehen.
• Der Unterricht ist der Ort der Bildung, nicht Strukturen und nicht Systeme. Der Unterricht ist das Hauptgeschäft der Lehrpersonen.
• Überzeugend finde ich auch die Ausführungen zum Expertenlehrer. Es wird deutlich gemacht, dass das nichts mit dem Dienstalter zu tun hat, sondern mit der Einstellung und dem Handeln der Lehrpersonen. Das staatliche Beurteilungssystem erscheint in diesem Zusammenhang absurd.
• Der Lernende soll als der Ausgangspunkt für Erziehung und Unterricht angesehen werden. Die Lehrer-Schüler-Beziehung, die einen der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches Lehren und sichtbares Lernen darstellt, muss auf Kooperation und Akzeptanz beruhen.
Unter der Überschrift „Was ist eine passende Schule?“ wird auch zur Hauptschule Stellung genommen. Es heißt auf den Seiten 102/103): „Wenn es einer Schulart nicht gelingt, ihre Absolventen in die Arbeitswelt zu überführen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, einen Stand im Leben zu gewinnen, weil beispielsweise Wirtschaftsunternehmen lieber (schlechter qualifizierte) Realschüler oder Gymnasiasten nehmen, dann hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren.“ Mein persönlicher Eindruck von der Mittelschule, wie die frühere Hauptschule jetzt genannt wird, ist positiver. Nach meiner Meinung wird die Basis für die Bildung in der Grundschule gelegt, und die verlassen viele Schüler nicht mit einer ausreichenden Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz, was sich nachteilig auf die weitere Schulkarriere (insbesondere in der Mittelschule, wo der Großteil davon landet) auswirkt.
An vielen Stellen des Buches werde ich an meine frühere Arbeitswelt erinnert. Da gibt es viele Parallelen, was den Umgang mit Mitarbeitern oder die Führungsfunktionen anbetrifft. Besonders die Stelle hat mir gefallen, wo es heißt, dass der Lehrer seinen Unterricht mit den Augen seiner Schüler sehen sollte. Mein Motto als Service- und Vertriebschef war: Im Kopf des Kunden denken. Das wird hier auf die Schule adaptiert.